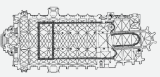| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Thomaskirche (Leipzig)
Die Thomaskirche in Leipzig ist – zusammen mit der Nikolaikirche – eine der beiden Hauptkirchen der Stadt und als Wirkungsstätte Johann Sebastian Bachs und des Thomanerchores weltweit bekannt.
Geschichte
Zwischen 1212 und 1222 wurde die ältere Marktkirche zur Stiftskirche des neuen Thomasklosters der Augustiner-Chorherren umgebaut. Der Minnesänger Heinrich von Morungen soll dem Thomaskloster anlässlich seines Eintritts eine Reliquie des Hl. Thomas geschenkt haben, die er aus Indien mitgebracht hatte. Reste des romanischen Baus kamen bei archäologischen Grabungen zu Tage.
Der Thomanerchor wurde bereits 1212 gegründet und ist somit einer der ältesten Knabenchöre Deutschlands. Im Laufe der Geschichte bekleideten immer wieder bedeutende Komponisten und ausübende Musiker das angesehene Amt des Thomaskantors.
Nach einem fast vollständigen Neubau wurde die Kirche durch den Merseburger Bischof Thilo von Trotha am 10. April 1496 erneut geweiht. Im Laufe der Jahrhunderte erfuhr die Kirche einige Zusätze und Umbauten; am bedeutendsten ist dabei der achteckige Turm aus der Zeit der Renaissance.
Zu Pfingsten 1539 predigte hier der Reformator Martin Luther.
Die äußere Gestalt der Kirche ist vor allem von Renovierungen und Umbauten des 19. Jahrhunderts geprägt. Nachdem die Kirche 1869 vom Besitz des Rates in die Selbstverwaltung der Kirchengemeinde überlassen worden war, fanden rund 30 Jahre lang historisierende Umbauten an der Außenfassade statt. Die neogotische Schaufassade wurde nach Entwürfen von Constantin Lipsius ausgeführt, während gleichzeitig alle gotischen und renaissancezeitlichen Fassadenelemente entfernt wurden.
Der Turm enthielt von alters her die Wohnung des Türmers. Der letzte Türmer zog 1917 aus.[1]
Beim Luftangriff auf Leipzig am 4. Dezember 1943 entstanden Schäden am gesamten Bauwerk. Der Luftangriff hat auch große Teile der die Kirche einst umgebenden Bebauung zerstört, so dass bei den Wiederherstellungen nach Kriegsende weitere Fassadenumgestaltungen notwendig wurden. Hierbei ist vor allem der einheitliche Putz zu nennen, während weite Teile der durch fehlende Anbauten freigewordenen Fassade nur aus unverputztem Backsteinmauerwerk bestanden hatten.
Anlässlich des Bachjahres 1950 wurden die Gebeine Bachs, der hier von 1723 bis zu seinem Tode 1750 Thomaskantor war, aus der zerstörten Johanniskirche überführt.
Architektur
Die dreischiffige Hallenkirche hat eine Gesamtlänge von 76 m. Die Länge des Hauptschiffs beträgt 50 m, die Breite 25 m und die Höhe 18 m. Der Chor ist gegen das Langhaus leicht abgewinkelt. Das Dach hat einen ungewöhnlich steilen Neigungswinkel von 63° und ist damit eines der steilsten Giebeldächer Deutschlands. Im Inneren verfügt es über sieben Ebenen (Firsthöhe 45 m). Der Turm hat eine Höhe von 68 m. Die Decke des Langhauses besteht aus einem farblich abgesetzten Kreuzrippengewölbe.
Innenraum und Ausstattung
Bornscher Altar (1721–1887)
Der barocke Portikus-Altar oder Bornsche Altar in der Thomaskirche zu Leipzig war von 1721 bis 1887 dort aufgestellt. Benannt ist er nach dem Mäzen Jacob Born (1638–1709), Präsident des Leipziger Konsistoriums. Die wesentlichen Künstler waren Giovanni Maria Fossati und der Bildhauer Paul Heermann (1673–1732).[2] Den Marmor zum Bau des Altars stiftete August der Starke, und nach dem Neubau der Leipziger Johanniskirche durch Hugo Licht wurde der Altar 1897 im dortigen neobarocken Chorraum aufgestellt[3]. Dort wurde er am 4. Dezember 1943 ein Opfer der Bomben.
Pauliner-Altar (1993–2014)
Der gotische Pauliner-Altar aus dem 15. Jahrhundert befand sich ursprünglich in der Universitätskirche St. Pauli. Diese wurde 1968 gesprengt. Der Altar konnte gerettet werden, wurde in der Thomaskirche 1993 als Altarretabel aufgestellt und befand sich dort bis zum 25. Oktober 2014.[4]
Neugotischer Jesus-Altar
Der 1888 nach dem theologischen Bildprogramm von Superintendent Oskar Pank unter der Leitung des Architekten Constantin Lipsius entworfene und errichtete Altar war in den 1960er Jahren in die Südsakristei der Kirche umgestellt worden. Nach zweijähriger Restaurierungsphase, im Zuge derer das Retabel restauriert und ein neuer Altartisch aufgestellt wurden, konnte der Jesus-Altar nach 53 Jahren aus der Petzoldt-Sakristei in den Altarraum der Thomaskirche zurückgeführt werden. Im Gottesdienst am 28. August 2016 wurde er wieder in den Dienst genommen.
Taufstein
Der Taufstein wurde in den Jahren 1614/15 von Franz Döteber geschaffen. Er ist aus Marmor und Alabaster gefertigt. An ihm sind biblische Szenen dargestellt. 2009 wurde er restauriert.
Epitaphe
In der Kirche befinden sich zahlreiche Grabplatten und Epitaphe, darunter die spätgotischen Grabplatten des Nickel Pflugk († 1482) und des Ritters Hermann von Harras aus Lichtenwalde († 1451), die unter der Südempore links vom Seiteneingang angebracht ist. Im nördlichen Vierungsraum hängt das Epitaph für den Ratsherrn Daniel Leicher von 1612.
Epitaph der Familie Pistoris
Grabstätte von J. S. Bach
In der Thomaskirche befinden sich seit 1950 die Gebeine von Johann Sebastian Bach. Nach seinem Tod am 28. Juli 1750 wurde Bach auf dem Spitalfriedhof der Johanniskirche bestattet. Im Zuge der im 19. Jahrhundert einsetzenden Bach-Renaissance begann sich eine breite Öffentlichkeit für die Gebeine und den genauen Ort der Grabstätte Bachs zu interessieren. Daher beauftragte man im Jahre 1894 den Anatomieprofessor Wilhelm His, aus exhumierten Knochen die Gebeine Bachs zu identifizieren. His kam dabei zu dem Urteil, dass „die Annahme, daß die am 22. October 1894 an der Johannis-Kirche in einem eichenen Sarge aufgefundenen Gebeine eines älteren Mannes die Gebeine von Johann Sebastian Bach seien“, in hohem Maße wahrscheinlich sei. Am 16. Juli 1900 wurden die Gebeine in einem Steinsarkophag unter der Johanniskirche wiederum beigesetzt.[5]
Im Zuge der Bombardierung Leipzigs am 4. Dezember 1943 wurde die Johanniskirche zerstört. Der Sarkophag mit den Gebeinen Bachs blieb unversehrt. Nach Diskussionen über Ort und Gestaltung einer neuen Grabstätte entschloss man sich 1949, Bach „im Chorraum beizusetzen, wo sich die räumlich größte Höhe der Kirche mit ihrem heiligsten Raum schneidet“. Am 28. Juli 1949 wurden die Gebeine in die Thomaskirche überführt und zunächst notdürftig in der Nordsakristei aufgebahrt. Dort wurden sie bis zur Schließung des Sargdeckels am 13. August 1949 Tag und Nacht von Gemeindemitgliedern bewacht. Die neue, nach einem Entwurf des Leipziger Architekten Kunz Nierade in den Stufen zum Chorraum gelegene Grabstätte wurde am 28. Juli 1950, dem 200. Todestag Bachs eingeweiht. Im Zuge der von 1961 bis 1964 dauernden Innenrenovierung der Thomaskirche wurde die Grabstätte unter Verwendung der Bronzeplatte von 1950 in den Chorraum verlegt.[5]
Kirchenfenster
Die Thomaskirche hatte ursprünglich eine einfache Ornamentverglasung. Erst nach 1889 wurden im Chorraum und an der Südseite farbige Fenster eingesetzt. Die fünf Chorfenster schuf Professor Alexander Linnemann aus Frankfurt am Main. Das einzige im Zweiten Weltkrieg zerstörte Chorraumfenster wurde im Jahr 2000 durch das Thomas-Fenster nach einem Entwurf von Hans Gottfried von Stockhausen ersetzt.
Die Fenster auf der Südseite zeigen die folgenden Motive: Gedächtnis-Fenster für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges; König Gustav II. Adolf von Schweden; Johann Sebastian Bach; Martin Luther mit Kurfürst Friedrich dem Weisen von Sachsen (links) und Philipp Melanchthon (rechts); Felix Mendelssohn Bartholdy (seit 1997); Kaiser Wilhelm I. Im Oktober 2009 wurde diese Reihe ergänzt durch das Friedens-Fenster im Entwurf von David Schnell, das an 20 Jahre friedliche Revolution erinnert.[6]
- Mosaikfenster auf der Südseite der Thomaskirche in Leipzig
Orgeln
Die Geschichte der Orgeln der Thomaskirche lässt sich bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen. Im Jahre 1489 wird eine „Kleine Orgel“ schriftlich erwähnt. 1511 wurde von Blasius Lehmann auf der Westempore eine große Orgel gebaut, die 1601 durch ein dreimanualiges Instrument von Johann Lange (Kamenz) mit 25 Registern ersetzt oder vergrößert wurde. Erweiterungen und Renovierungen folgten 1619 durch Josias Ibach, 1721/1722 durch Johann Scheibe und 1772/1773 durch Johann Gottlieb Mauer. 1639 wurde eine Schwalbennestorgel auf einer neuen Empore über dem Triumphbogen gebaut, die 1740 abgetragen wurde. Bachs Matthäuspassion wurde 1736 „mit beyden orgeln“ aufgeführt.[7] Auf der Hauptorgel spielte Mozart am 12. Mai 1789. Diese Orgel wurde 1889 durch ein Instrument von Sauer ersetzt.
Ehemalige Schuke-Orgel
Da sich Musik aus der Barockzeit auf der romantisch disponierten Sauer-Orgel mit pneumatischer Traktur nur bedingt darbieten lässt, errichtete Alexander Schuke 1967 eine dreimanualige Orgel mit 47 Registern und mechanischer Traktur, die einen asymmetrischen, L-förmigen Grundriss hatte und in der Wandecke am Ostende der Nordempore stand. Ihr Prospekt war zeitgemäß modern, stark gegliedert und einfach gestaltet. Die Schuke-Orgel musste im Mai 1999 dem Neubau von Woehl weichen. 42 ihrer Register fanden eine Weiterverwendung in der 2005 geweihten Orgel im Fürstenwalder Dom St. Marien.[8]
Die Thomaskirche hat heute zwei große Orgeln:
Sauer-Orgel
Auf der großen Westempore, der Chorempore des Thomanerchores, steht die ältere der beiden großen Orgeln. Das romantische Instrument wurde in den Jahren 1885 bis 1889 von dem Orgelbauer Wilhelm Sauer erbaut. Die Orgel hatte zunächst 63 Register auf drei Manualen und Pedal. Im Jahre 1908 wurde die Disposition der Sauer-Orgel nach Vorschlägen von Karl Straube 1908 auf insgesamt 88 Register erweitert. Die Spiel- und Registertrakturen sind als Zustrom-Pneumatik ausgeführt. Die Stimmung ist gleichstufig und liegt bei a1= 440 Hz. Die Sauer-Orgel gilt als ideal zur Darstellung der Orgelmusik Max Regers. Bis zum Jahre 2005 wurde die Sauer-Orgel durch die Orgelwerkstatt Christian Scheffler restauriert und auf ihren Originalzustand aus dem Jahr 1908 zurückgeführt.
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Koppeln: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P
- Spielhilfen: Mezzoforte, Forte, Tutti, Rohrwerke, Piano-, Mezzoforte-, Forte- und Tuttipedal mit Absteller, Handregister ab drei frei einstellbare Kombinationen, Rollschweller mit Absteller
Woehl-Orgel
Im Bachjahr 2000 errichtete der Orgelbauer Gerald Woehl (Marburg) an der Nordwand auf der Nordempore gegenüber dem Bach-Fenster eine weitere Orgel, auch Bach-Orgel genannt. Dieses Instrument dient maßgeblich der Wiedergabe der Orgelwerke Johann Sebastian Bachs.
Äußerlich nimmt das Instrument Elemente des barocken Prospekts der ehemaligen, von Bach im Jahr 1717 abgenommenen Scheibe-Orgel der 1968 gesprengten Universitätskirche St. Pauli auf. Woehl passte den Prospekt an die räumlichen Verhältnisse in der Thomaskirche und an die viermanualige Disposition des neuen Instruments an, das durch ein zusätzliches Oberwerk gekrönt wird. Durch das barock gegliederte, sich zur Mitte hin konzentrierende Gehäuse soll der Charakter der Orgel als ein barockes Instrument zum Ausdruck kommen. Demgegenüber sind viele Details, etwa die Rahmenprofile und Gehäuseschwünge, das Bach-Emblem in der Mitte der Orgel, die Bekrönung über dem Spieltisch und die beiden Zimbelsterne modern gestaltet.[9]
Die Woehl-Orgel hat 61 Register (4266 Pfeifen) auf vier Manualwerken und Pedal. Die Spielanlage befindet sich mittig unter dem Brustwerk. Das Instrument orientiert sich klanglich an Orgeln des mitteldeutschen Orgelbaus des 18. Jahrhunderts. Grundlage für die Disposition war der Entwurf von Johann Christoph Bach I für die Stertzing-Orgel der Georgenkirche Eisenach (1697–1707), wobei nicht alle Register ausgeführt wurden.[10] Die Orgel der Thomaskirche verfügt als Effektregister über zwei Zimbelsterne, ein Glockenspiel und zweierlei Arten von „Vogelgeschrei“. Die Spiel- und Registertrakturen sind mechanisch.
Die Windanlage ist unter den Emporenpodesten untergebracht, getrennt für Manualwerke (links) und Pedalwerk (rechts); sie besteht jeweils aus zwei Keilbälgen, Vorlag und Windmotor. Mittels eines Hebels (Kammerkoppel) besteht die Möglichkeit, das ganze Werk auf zwei verschiedene Tonhöhen umzustellen – einen Halbton höher im Chorton bzw. tiefer im Kammerton. Die Stimmung ist ungleichstufig (nach Neidhardt) und liegt bei a1= 465 Hz (Chorton), was dem üblichen Stimmton von Leipziger Orgeln der Bach-Zeit entspricht, oder a1= 415 Hz (tiefer Kammerton) für das Zusammenspiel mit Barockinstrumenten. Tonumfang Chorton: Manuale C–f3, Pedal C–f1; Tonumfang Kammerton: Manuale CD–f3, Pedal CD–f1.[11]
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Koppeln: III/II, IV/II, II/P, III/P.
- Tremulant für das ganze Werk
- Effektregister: Glockenspiel, zwei Zimbelsterne, Vogell Geschrey
Seit 2006 wird die Kirche durch eine Truhenorgel für das Continuo-Spiel bereichert, die ebenfalls aus der Werkstatt Gerald Woehl stammt.
Thomasorganist
Glocken
Vier Glocken hängen im Turm der Thomaskirche. Die größte Kirchenglocke ist die Gloriosa und läutet nur an hohen Festtagen. Theodericus Reinhard goss sie im Jahre 1477 mit einem Gewicht von 5.200 kg bei einem Durchmesser von 204 cm. Die Ritzzeichnungen der Glocke mit einer Höhe von 74 cm schuf Nikolaus Eisenberg. Ihr Schlagton ist a0.
Die zweitgrößte Glocke ertönt im Schlagton c1 und wurde 1574 von Wolf Hilliger gegossen. Die Mönchs- oder Beichtglocke ist die drittgrößte Glocke im Schlagton d1. Jakob König hat sie im Jahre 1634 gegossen; sie dient auch als Stundenglocke.
Die vierte Glocke läutet zum Gebet. Sie wurde 1585 von Christophorus Gros gegossen und erklingt auf f2. Die Singfreudigkeit des Geläuts wird durch die Aufhängung an verkröpften Stahljochen stark beeinträchtigt. Separat in der Turmlaterne hängt eine Schlagglocke für die Viertelstunden, die von der Glockengießerei Schilling in Apolda nach dem Vorbild der Vorgängerin von 1539 gegossen wurde.
| Nr. |
Name |
Gussjahr |
Gießer |
Durchmesser (mm) |
Gewicht (kg) |
Nominal (16tel) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloriosa | 1477 | Theodericus Reinhard | 2040 | 5.200 | a0 |
| 2 | 1574 | Wolf Hilliger | c1 | |||
| 3 | Mönchs- oder Beichtglocke | 1634 | Jakob König | d1 | ||
| 4 | 1585 | Christophorus Gros | f2 |
Im März 2017 berichtete die Leipziger Volkszeitung vom dringend erforderlichen Vorhaben, die historischen Glocken und ihre Glockenstühle umfassend zu restaurieren.[12] Außerdem soll das Geläut um mindestens 3 Glocken mit den Schlagtönen c2, g2 und a2 ergänzt werden.[13]
Außenbereich
Vor dem Seiteneingang der Thomaskirche steht ein Denkmal für Johann Sebastian Bach des Bildhauers Carl Seffner aus dem Jahre 1908. Ein älteres Bach-Denkmal, das mit Unterstützung Felix Mendelssohn Bartholdys 1843 geschaffen wurde, befindet sich in den Grünanlagen vor dem Haupteingang, ebenso ein Denkmal für Mendelssohn. An der Nordwestecke der Kirche ist eine Gedenktafel für Johann Adam Hiller angebracht, die aus einem früheren Denkmal stammt.
Ort der Musik
In der Thomaskirche treten regelmäßig der Thomanerchor und das Gewandhausorchester auf. Freitags um 18:00 Uhr, samstags um 15:00 Uhr in der Motette und sonntags im Gottesdienst um 9:30 Uhr. Zu besonderen Anlässen und Festtagen werden Thomaskonzerte vorwiegend mit Werken von Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy aufgeführt.
In der Kirche wurden viele Werke Johann Sebastian Bachs uraufgeführt. Nachdem Bachs Werke in Leipzig weitgehend in Vergessenheit geraten waren, begann Mendelssohn damit, sie wieder aufzuführen, und begründete damit die Tradition der Leipziger Bachpflege.
Auch einige Werke anderer Komponisten wurden in der Thomaskirche uraufgeführt, beispielsweise die Sinfoniekantate Lobgesang von Felix Mendelssohn Bartholdy.
Förderverein
Der Thomaskirche – Bach e. V. wurde 1997 auf Initiative von Sup. Johannes Richter gegründet. Seitdem hat er die Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Thomas mit 5,5 Millionen Euro unterstützt. Der Förderverein zählt mittlerweile über 300 Mitglieder weltweit.
Die Ziele des Vereins sind die Förderung der Erhaltung der Thomaskirche, des Thomashauses (Nachfolgegebäude der alten Thomasschule) und die Pflege der Kirchenmusik, insbesondere des Werkes Johann Sebastian Bachs. Dem Engagement des Fördervereins ist es u. a. zu verdanken, dass die Thomaskirche Leipzig anlässlich des 250. Todestages von Johann Sebastian Bach vollständig restauriert werden konnte. Mit den Spenden, die der Verein akquiriert, hilft er, die Thomaskirche als Ort des Glaubens, des Geistes und der Musik zu erhalten und verschiedene Projekte zu finanzieren. Dazu gehören die Sanierung der beiden Orgeln sowie die Rückführung des neugotischen Jesus-Altars an seinen ursprünglichen Platz im Altarraum der Thomaskirche. Im Oktober 2017 initiierte der Thomaskirche – Bach e. V. eine Spendenkampagne zur Restaurierung und Erweiterung des historischen Geläuts der Thomaskirche, die bis Ende 2019 Euro 350.000 einbringen soll.
Weiterhin wurde der Thomasshop bzw. die Thomaskirche-Bach-2000-Marketing-GmbH gegründet. Die Verkaufserlöse des Thomasshops kommen der Thomaskirche zugute.
Literatur
- Cornelius Gurlitt: Thomaskirche. In: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen, 17. Heft: Stadt Leipzig (I. Theil). C. C. Meinhold, Dresden 1895, S. 40.
- Carl Niedner: Das Patrozinium der Augustiner-Chorherren-Stiftskirche St. Thomae zu Leipzig. Untersuchungen zur Frühgeschichte der Bach-Kirche und der Leipziger Altstadt. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1952.
- Gunter Hempel: Episoden um die Thomaskirche und die Thomaner. Tauchaer Verlag, Taucha 1997, ISBN 3-910074-67-7.
- Stefan Altner: Thomanerchor und Thomaskirche. Historisches und Gegenwärtiges in Bildern. Tauchaer Verlag, Taucha 1998, ISBN 3-910074-84-7.
- Martin Petzoldt: St. Thomas zu Leipzig. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2000, ISBN 3-374-01842-4.
- Christian Wolff: Die Thomaskanzel. Orientierung zwischen Zweifel und Gewissheit. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2004, ISBN 3-374-02122-0.
- Christian Wolff (Hrsg.): St. Thomas Church in Leipzig. A Place of Faith, Spirit and Music. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2004, ISBN 3-374-02190-5.
- Christian Wolff (Hrsg.): Die Thomaskirche zu Leipzig. Ort des Glaubens, des Geistes, der Musik. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2004, ISBN 3-374-02169-7.
- Christian Wolff (Hrsg.): Die Orgeln der Thomaskirche zu Leipzig. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2005, ISBN 3-374-02300-2.
- Textheft zur CD "Die neue Bach-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig"
- Alberto Schwarz: Das Alte Leipzig – Stadtbild und Architektur, Beucha 2018, S. 85 ff., ISBN 978-3-86729-226-9.
Weblinks
- Literatur von und über Thomaskirche (Leipzig) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Suche nach „Thomaskirche Leipzig“ in der Deutschen Digitalen Bibliothek
- Suche nach „Thomaskirche Leipzig“ im Portal SPK digital der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
- www.thomaskirche.org offizielle Webpräsenz
- Thomaskirche im Leipzig-Lexikon
Einzelnachweise
- ↑ Interessante Ereignisse und Daten. In: Website Thomaskirche. Abgerufen am 23. Januar 2019.
- ↑ Martin Petzoldt: Die Altäre der Thomaskirche zu Leipzig. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2012, ISBN 978-3-374-03061-3, S. 42–51.
- ↑ Johanniskirche, Leipzig.. In: Zeitschrift für Bauwesen. 51, 1901.
- ↑ leipzig.de – Der Paulineraltar steht wieder am Augustusplatz (24. Oktober 2014)
- ↑ 5,0 5,1 Bildtafel „Das Bachgrab in der Thomaskirche“, ausgestellt in der Thomaskirche zu Leipzig. Lokalaugenschein am 9. August 2011.
- ↑ Kirchenführer: Thomaskirche: Ort des Glaubens, des Geistes, der Musik
- ↑ Neumann (Hrsg.): Fremdschriftliche und gedruckte Dokumente zur Lebensgeschichte Johann Sebastian Bachs 1685–1750. 1969, S. 141.
- ↑ St. Marien-Domkantorei: Domorgel (Memento vom 24. Juli 2017 im Internet Archive), abgerufen am 1. April 2015.
- ↑ Zum Konzept der Orgel (Memento vom 3. Februar 2015 im Internet Archive) auf orgelbau-woehl.de.
- ↑ Felix Friedrich, Vitus Froesch: Orgeln in Sachsen – Ein Reiseführer. Kamprad, Altenburg 2012, ISBN 978-3-930550-89-0, S. 15.
- ↑ Informationen zur Bach-Orgel
- ↑ http://www.lvz.de/Leipzig/Lokales/Historisches-Leipziger-Gelaeut-braucht-eine-Kur
- ↑ Vgl. die Informationen auf der fundraising-Site für das Projekt
| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Thomaskirche (Leipzig) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |