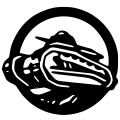| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Renault
| Renault SA | |
|---|---|

| |
| Rechtsform | Société Anonyme (Aktiengesellschaft) |
| ISIN | FR0000131906 |
| Gründung | 1898 |
| Sitz | Boulogne-Billancourt, Frankreich |
| Leitung | Carlos Ghosn |
| Mitarbeiter | 128.000 (31. Dezember 2011)[1] |
| Umsatz | 42.628 Mio. EUR (2011)[1] |
| Gewinn | 2.139 Mio. EUR (2011)[1] |
| Bilanzsumme | 72.934 Mio. EUR (31. Dezember 2011)[1] |
| Branche | Automobilhersteller |
| Website | www.renault.com |
[ʀəˈno] ist ein französischer Automobilhersteller. Nach der strategischen Allianz zwischen Renault und Nissan im Frühjahr 1999 ist Renault-Nissan einer der größten Automobilhersteller der Welt. Weltweit arbeiten über 128.000 Mitarbeiter bei Renault und produzierten im Jahr 2011 rund 2,722 Millionen Fahrzeuge.[1] Es ist mit großem Abstand die stärkste ausländische Automobilmarke in Deutschland und hält einen Marktanteil von 5,9 Prozent (2011) bei den Pkw und den leichten Nutzfahrzeugen.
Geschichte
Gründung und Anfangsjahre
Die Société Renault Frères (Unternehmen der Gebrüder Renault) wurde von Louis, Fernand (1865–1909) und Marcel Renault (1872–1903) am 25. Februar 1899 offiziell gegründet.[2] Allerdings gilt der Weihnachtsabend 1898 als Geburtsstunde der Renault-Werke. An diesem Tag war Louis Renault mit seinem in einem Schuppen in Boulogne-Billancourt selbst zusammengebauten hölzernen Automobil in Paris unterwegs. Er erhielt noch am gleichen Abend zwölf Aufträge zum Nachbau seines ersten Automobils, dem später als Modell A bezeichneten Typs.
Louis Renault leitete das Unternehmen nach dem Tod seiner Brüder allein, bis er im Oktober 1944 verstarb.
Neben der Leitung war er weiterhin als Techniker tätig. Dies führte über die Jahre zu zahlreichen Patenten, die die automobile Welt weiter brachten. Beispielhaft seien hier die Kardanwelle, die einschraubbare Zündkerze oder der Turbokompressor (Turbolader) genannt, ebenso der Sicherheitsgurt, der erste V8-Motor für ein Flugzeug und die Trommelbremse.
Die Entwicklung des Familienunternehmens schritt schnell voran, so beschäftigte Renault um 1900 schon über 100 Mitarbeiter. Den Durchbruch zum großen Industriekonzern schaffte Renault im Jahr 1906, als ein Pariser Taxiunternehmen 250 Taxis bei Renault bestellte.
Das frühe 20. Jahrhundert
Renault begann schon früh mit der Produktion von Nutzfahrzeugen. 1909 gab es bereits Drei- und Fünftonner, 1915 eine Zugmaschine mit Allradantrieb und -lenkung. 1913 produzierte Renault das zehntausendste Fahrzeug. Diese Zahl an Autos reichte fast an die Produktionszahlen von Ford und war in Europa einzigartig.
Während des Ersten Weltkriegs wurden Militär-Lkw, Flugmotoren sowie Munition hergestellt. Renault zeichnete sich auch hier durch innovative technische Lösungen aus. So war der Renault FT-17 der erste Panzer mit einem drehbaren Turm und einer selbsttragenden Wanne.
Ein Mythos des Weltkrieges wurde der Renault Type AG, das vornehmlich von Taxifahrern genutzt wurde: Als zu Beginn des Krieges die Truppen nicht schnell genug zur Front an die Marne gebracht werden konnten, übernahmen das die Pariser Taxifahrer mit den „Marnetaxis“ von Renault. Durch seine Tätigkeit für Frankreich im Ersten Weltkrieg war Renault nationaler Held geworden, er wurde deshalb 1918 zum Offizier der Ehrenlegion ernannt.
Die Zeit zwischen den Weltkriegen

Nach dem Ersten Weltkrieg nahm Renault die Automobilproduktion mit leicht modifizierten Vorkriegsmodellen wieder auf. Aber bald schon expandierte Renault nicht nur bei der Vielzahl seiner Automodelle, sondern wagte sich auch in weitere Sparten vor, wie der Produktion von Bootsmotoren, Lokomotiven und Flugzeugen (Renault erwarb 1933 den Flugzeughersteller Caudron). Außerdem wurden erste Traktoren entwickelt und gebaut. Eine der Fertigungsstätten wurde ab Mitte der 1930er Jahre Le Mans.
1929 wurde der erste Diesel-Lkw vorgestellt, die seit den 1930er Jahren eine große Verbreitung fanden. Zur Zeit der Weltwirtschaftskrise ging die Produktion in die Richtung energiesparender Fahrzeuge. So verbrauchte der Renault 6CV um die 3,7 Liter Kraftstoff auf 100 km.
In den 1930er Jahren baute Renault eine Produktionsstätte auf der Seine-Insel Séguin auf. Auf der 70.000 m² großen Insel entstand das damals größte und modernste Automobilwerk in Europa, das noch heute als Stammwerk gilt.[3] Außerhalb der USA war Renault nun im Besitz der längsten Fließbandstraße, die 1,5 km lang war. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs produzierte Renault überwiegend repräsentative Luxusautomobile.
Weil Louis Zulieferer für unzuverlässig hielt, machte er sich durch Eigenproduktionen wie Stahlblech und Zündkerzen unabhängig. Selbst ein eigenes Kraftwerk wurde errichtet. Daneben wurden auch Gullydeckel und kleinere Haushaltsartikel wie Kantinenbesteck und Watte hergestellt (hier wurde er zeitweilig der größte Wattefabrikant des Landes).
Der Zweite Weltkrieg und die Zeit danach
1939 bis 1944 (Zweiter Weltkrieg)
Nach dem Westfeldzug der Wehrmacht wurde Frankreich im Juni 1940 von der deutschen Reichsregierung zu einem kapitulationsähnlichen Waffenstillstand gezwungen; ein Teil Frankreichs wurde besetzt, der andere Teil vom Vichy-Regime verwaltet. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Paris (14. Juni 1940) wurden Renault unter deutsche Zwangsverwaltung gestellt und produzierte und reparierte Lkw und Panzer für die Wehrmacht. Dabei verfünffachte sich zwischen 1940 und 1942 der Renault-Umsatz. Die deutschen Verwalter Schippert und von Urach wurden von der Daimler-Benz AG abgestellt. Im März und im April 1942 waren die Renault-Werke Angriffsziele der Alliierten. Nach einem weiteren Angriff im September 1943 kam die Produktion praktisch zum Erliegen.
Verstaatlichung
Louis Renault (1877–1944) stellte sich nach der Befreiung von Paris (Ende August 1944) der Polizei. Ihm wurde Kollaboration (Zusammenarbeit mit den Besatzern) vorgeworfen, er kam in Haft. Er starb am 24. Oktober 1944 in einem Pariser Krankenhaus – ob an den Folgen einer Urämie (Harnvergiftung) oder an den Folgen von Misshandlungen während der Haft in Fresnes konnte nie eindeutig geklärt werden.
Noch während Renaults Inhaftierung wurde Pierre Lefaucheux kommissarisch als Verwalter in Boulogne-Billancourt eingesetzt, offiziell wurden die Renault-Werke am 16. Januar 1945 von der vorläufigen Regierung verstaatlicht und Pierre Lefaucheux als Generaldirektor eingesetzt. Der Unternehmensname (Firma) war nunmehr Régie Nationale des Usines Renault (Staatliche Verwaltung der Renault-Werke).
Die Automobilproduktion beschränkte sich nach dem Zweiten Weltkrieg einzig auf den heimlich im Krieg entwickelten Renault 4CV (Crèmeschnittchen), der 1946 offiziell vorgestellt wurde. Die Nachfrage war so groß, dass schon 1947 die Lieferfrist über ein Jahr betrug. Die Monatsproduktion von 7750 Fahrzeugen im Herbst 1948 brach den Vorkriegsrekord. 1949 waren die Renault-Werke größter Automobil-Produzent Frankreichs. In diesem Jahr wurde auch ein Büro in Baden-Baden eröffnet.
Expansion in Europa
1950 baute Renault in Valladolid (Spanien) das FASA-Werk, später folgten weitere spanische Werke in Palencia sowie in Sevilla. Das Unternehmen FASA wurde mit spanischem Privatkapital gegründet und in den folgenden Jahren schrittweise zu 100 Prozent von Renault übernommen. Der Name FASA-Renault blieb bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts, anschließend firmierte das Werk als Renault España.
Neue Lastwagenproduktion
Aus dem Zusammenschluss der Produktion schwerer Lkw von Renault mit Latil und Somua entstand 1955 Saviem. Die Gründung von Saviem war die erste Amtshandlung von Lefaucheux' Nachfolger Pierre Dreyfus. Lefaucheux verunglückte im Februar 1955 tödlich, als er nach St. Dizier fahren wollte. Das erste Modell, das unter Dreyfus debütierte, war die sehr erfolgreiche Dauphine.
Soziales Engagement und internationaler Durchbruch der Renault Kraftwagen
Unter dem Aspekt, ein Konzern des Volkes zu sein, setzte Renault in den 1960er Jahren die bezahlte dritte und vierte Urlaubswoche durch. Die Produktion brachte zu dieser Zeit revolutionäre Modelle wie den Renault 4 oder den Renault 16 hervor. Auch der Renault 12 muss zu den bedeutenden Modellen gezählt werden, im Hinblick auf seine Produktionszahlen und seine Verbreitung in der Welt. Der Renault 12 war das erste wirkliche Weltauto von Renault, noch bis zum Ende des Jahrtausends wurde er in Rumänien von Dacia, in der Türkei von Oyak Renault und von Ford in Brasilien als Ford Corcel gefertigt. Schon damals setzte Renault auf den Export und kam damit nicht nur in Frankreich an die Spitze der Zulassungen, sondern auch in Europa weit nach vorne.
In der folgenden Zeit wuchs Renault unaufhörlich und versuchte, mit anderen Unternehmen zu kooperieren bzw. durch Unternehmensaufkäufe weiter zu expandieren. Auf Betreiben des französischen Staates wurde 1975 der Nutzfahrzeughersteller Berliet in den Renault-Konzern integriert und 1978 mit Saviem zum neuen Unternehmen Renault Véhicules Industriels (kurz: RVI) zusammengeschlossen. Die beiden bisherigen Markennamen wurden noch bis 1980 weitergeführt, dann aber von der Marke Renault ersetzt, die damit erstmals seit 1957 wieder an mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen erscheint.
Wirtschaftliche Erfolge weltweit
Von 1961 bis 1969 stiegen die Jahres-Produktionszahlen von 413.000 auf über eine Million Einheiten und weitere Werke wurden gebaut. Für den R16 wurde 1963 in Sandouville bei Le Havre ein Montagewerk errichtet. 1969 wurde der Bau des Karosserie- und Montagewerks Douai und die Verdoppelung der Kapazität von Sandouville beschlossen. Die Produktionen der Dauphine und des R4 wurden ausgelagert nach Córdoba (Argentinien), die Montage des R12 erfolgte in Rumänien als Dacia 1300. Des Weiteren wurde eine Tochtergesellschaft in Mexiko eingerichtet; zusammen mit Peugeot entstand ein Montagewerk in Peru. Der erste Exportmarkt wurde 1962 Deutschland. 1970 hatte Renault hier mit 170.000 abgesetzten Einheiten bereits einen Marktanteil von 7 Prozent erreicht; Renault war damit größter Autoimporteur in Deutschland.
Anknüpfend an die Herstellung erster eigener Traktoren kaufte die Konzernleitung 1962 die Sparte Porsche Traktor auf. Die Traktorensparte wurde gegen Beginn des neuen Jahrtausends vom deutschen Landmaschinenhersteller Claas übernommen, dessen Kapitalanteil seit Anfang 2006 bei 80 Prozent liegt.
Unternehmensinterne Probleme
Bereits bei den Studentenunruhen im Mai 1968 kam es im Stammwerk zu Streiks, die die Produktion fast einen Monat lang lahmlegten. Am 18. Juni 1968 nahmen die Arbeiter nach einer unternehmensinternen Einigung die Arbeit aber wieder auf. Gegen (oder für die Beibehaltung) der Produktionsbedingungen, aber womöglich auf 40 Stunden die Woche oder 60 Lebensjahre begrenzte Dauer, hatten sich die Beschäftigten zu Beginn der 1970er Jahre erneut aufgelehnt. Diese Aktionen wurden bei allen Automobilarbeitern als Renault-Streik 1971 bekannt. Linksradikale Gruppen solidarisierten sich mit diesem Streik bzw. agitierten vor den Werkstoren. Am 25. Februar 1972 kam Pierre Overney vor dem Stammwerk in Boulogne-Billancourt bei einer solchen Aktion zu Tode.
Weiter steigende Produktionszahlen
Von 1970 bis 1980 stieg die Produktionsziffer von einer Million auf zwei Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Grund war die fortschreitende Automatisierung durch Industrie-Roboter sowie die Einführung von Modellen, die den Zeitgeist trafen wie dem Renault 5. Außerdem wurden diverse andere Modelle mit wechselndem Erfolg eingeführt und durch die Alpine-Modelle die Öffentlichkeit breiter angesprochen. In Dieppe wurde 1976 das Werk Renault Sport neu eingeweiht und der neue Renault Alpine 310 mit V6-Motor vorgestellt. 1974 wurde der PRV-Motor vorgestellt, der in einer weiteren neuen Fabrik in Douvrin für den Renault 30 den Peugeot und Volvo in großen Stückzahlen produziert wurde. Im Jahr 1972 wurde das Signet der Renault-Werke, das bisherige Rhombus (zuletzt 1959 verändert), von Victor Vasarely neu interpretiert.
Im Jahr 1979 erwarb Renault eine Beteiligung von 10 Prozent am US-amerikanischen Lkw-Hersteller Mack Trucks, die bis 1983 schrittweise auf 40 Prozent aufgestockt und 1987 an RVI weitergegeben wurde.
1979 erzielte der Staatskonzern einen Gewinn von einer Milliarde Francs und brach alle bis dahin erzielten Produktions-, Export- und Inlandsverkaufsrekorde.
Ende des 20. Jahrhunderts
1983 übernahm die RVI das Unternehmen Dodge Europe. Im selben Jahr wurde der Baureihe G260/290 der Titel Truck of the Year verliehen. In Amerika wurden unter der Regie von Renault die Modelle R9 und R11 als AMC (American Motors Corporation) Alliance und Encore hergestellt und verkauft. Dabei entstand ein Cabriolet auf Basis des R9, das in dieser Form in Deutschland nie verkauft wurde. Gleichzeitig erhielten die legendären Jeeps Renault-Motoren und wurden über das europäische Renault-Händlernetz vertrieben.
Trotz der Erfolge bis Ende der Siebziger geriet die Régie Renault bald in eine schwere Krise: Die Produktion ging merklich zurück und 1984 wurden erstmals rote Zahlen in Milliardenhöhe geschrieben. Die zu Anfang der Ära François Mitterrand gewährten Sozialleistungen waren daran offensichtlich nicht unschuldig. Bis 1988 kam es weiterhin zu Verkaufsrückgängen in Frankreich und auch im Export, so dass in Deutschland der Marktanteil nur noch 2,8 Prozent betrug. Der Konzernchef Bernard Hanon, der 1981 auf Bernard Vernier Palliez gefolgt war, wurde 1985 vorzeitig von Georges Besse abgelöst. Besse startete einen drastischen Sanierungsplan, der massiven Stellenabbau und Verkauf von Aktivitäten und Beteiligungen umfasste.
Um der Krise zu entkommen, wurde die gesamte Kraft auf neue Produkte gesetzt und mit der Einführung des Renault Fuego Schritt für Schritt die gesamte Modellpalette erneuert. Sprösslinge dieser intensiven Bemühungen waren der Renault 25 und der Espace, der als Urtyp der Großraumlimousinen in Europa angesehen wird. Kurz danach gesellte sich noch der Renault 19 dazu und half dem Konzern, wieder Gewinn zu machen. Fachkreise nannten den R19 später den „Retter von Renault“.
Am 17. November 1986 wurde der französische Chef von Renault, Georges Besse, von Terroristen der Gruppe Action Directe erschossen. 1987 erwirtschaftete Renault wieder einen Gewinn von mehreren Milliarden Francs, nachdem 1986 das Defizit schon halbiert worden war. Gleichzeitig setzte Renault erneut auf Qualität mit der Richtlinie «Qualité Totale» und der Kommunikationslinie Autos zum Leben. Im Jahr 1990 kaufte die RVI die restlichen Anteile an Mack Trucks. 1991 wurde der AE Truck of the Year. Aus RVI entstand 1992 die Renault V.I. 1996 verkaufte der französische Staat seine Anteile, so dass 51 Jahre nach der Enteignung Renault wieder privatisiert wurde. Dem Unternehmen wurden zudem Schulden in Milliardenhöhe erlassen. Zwischenzeitlich war 1992 das Werk auf der Insel Seguin wegen Platzmangels geschlossen worden.
Renault im 21. Jahrhundert
Zukäufe und Verkäufe weiterer Unternehmen oder Marken
Die Renault-Lkw-Baureihe AE bot als erste ein COE-Fahrerhaus, das die Kabine komplett über dem Motor anordnete und – deutlich höher als bisher – den Fahrer beherbergte, wobei – wie bei den Unterflurfahrzeugen von Büssing – ein durchgehend ebener Boden und Stehhöhe vorhanden waren. Das wurde von der Transportwirtschaft gerne angenommen.
Um Möglichkeiten zur Senkung des Kraftstoffbedarfs zu demonstrieren, reduzierte Greenpeace mit vergleichsweise geringem Aufwand den Verbrauch des Twingo um 50 Prozent. Die 'Renault V.I.' wurde 2001 in die Lkw-Gruppe Volvo integriert und heißt seit 2002 Renault Trucks. Außerdem begann Renault mit dem finnischen Hersteller Sisu Auto zu kooperieren. 2001 firmierte die spanische Renault-Tochter Fabricación de Automóviles S.A. (FASA) in Renault España S.A. (RESA) um.
Nach der 1999 gegründeten Allianz Renault-Nissan beteiligte sich Renault im Jahr 2002 an dem Autokonzern Nissan zu 44 Prozent, später an Volvo mit 20 Prozent und kaufte die Automarken Dacia (Rumänien) und Samsung Motors (Südkorea).
Als einer der ersten Pkw-Hersteller in Europa engagierte sich Renault in der Türkei nahe Bursa. Die in den Jahren 1999 bis 2003 als Kombimodell abgesetzten Renault Mégane Grandtour 1 sind in der Türkei hergestellte Fahrzeuge.
Die Traktoren-Sparte Renault Agriculture wurde 2003 komplett von dem deutschen Landmaschinen-Hersteller Claas übernommen. Die Traktoren aus den französischen Werken tragen seitdem auch den Namen Claas und die markentypische grün-rote Lackierung.
Im Frühjahr 2006 untersuchten Renault und Nissan Ansatzpunkte einer Kooperation mit dem amerikanischen Autokonzern General Motors.
Im Jahr 2007 kritisierten Gewerkschaften wie die CGT schlechte Arbeitsbedingungen in einer Renault-Entwicklungsabteilung bei Paris, die sie mit Gesundheitsproblemen und Selbstmorden von Mitarbeitern in Verbindung brachten. Die Unternehmensleitung wies einen Zusammenhang zurück.[4] Ein französisches Gericht entschied 2009, dass Renault eine Mitschuld am Selbstmord eines Beschäftigten trage. Der 39-jährige Informatiker hatte sich im Oktober 2006 nach einem Gespräch mit einem Vorgesetzten aus dem fünften Stock eines Bürogebäudes gestürzt. Wegen grober Fahrlässigkeit verurteilten die Richter Renault dazu, eine symbolische Entschädigung von einem Euro sowie eine höhere Rente an die Angehörigen zu zahlen.[5]
Am 7. April 2010 wurde in Brüssel ein Kooperationsvertrag zwischen der Renault-Nissan Allianz und der Daimler AG geschlossen. Stellvertretend unterschrieben Carlos Ghosn und Dieter Zetsche den Vertrag, der erstens die Entwicklung einer gemeinsamen Kleinwagen-Plattform, zweitens den Einsatz gemeinsamer Motoren vorsieht und drittens eine engere Zusammenarbeit im leichten Nutzfahrzeugbereich zum Inhalt hat. Zudem bietet der Vertrag mehr Wirtschaftlichkeit und bessere Auslastung der Produktionsstrecken.[6]
Engagement im Autorennsport
Im Jahr 1968 hatten sich die Renault-Werke mit anderen Autoherstellern verbunden und eine erste Rennserie als Formel Renault ins Leben gerufen. Seitdem nutzen die Werksentwickler die Möglichkeiten, auf Autorennstrecken Innovationen zu testen. Bis 2009 wurde das eigene Rennteam Renault F1 unterhalten. Im Jahr 2005 gewann Renaults Formel-1-Team zusammen mit seinem Fahrer Fernando Alonso den Fahrer- und Konstrukteurstitel der Formel-1-Weltmeisterschaft. Im Jahr 2006 konnte das Rennteam mit seinem Fahrer Fernando Alonso erneut den Fahrer- und Konstrukteurstitel der Formel-1-Weltmeisterschaft gewinnen. Seit 2007 liefert Renault die Motoren für die Red-Bull-Wagen in der Formel 1. In den Jahren 2010 bis 2013 konnten sowohl Red-Bull wie auch Sebastian Vettel mit ihnen Konstrukteursweltmeister bzw. Weltmeister werden.
Perspektiven
Renault bringt seit 2011 verschiedene Elektrowagen (Z.E. = Zero Emission) auf den Markt.[7] Als erstes starten in Deutschland der Lieferwagen Kangoo Rapid Z.E. und der Stufenheckwagen Fluence Z.E. (beide ab Oktober 2011). Folgen werden der Zweisitzer Twizy (Anfang 2012) und der Kleinwagen ZOE (Mitte 2012). Die Motoren für den Kangoo und den Fluence werden von der deutschen Firma Continental in Gifhorn produziert und liefern bis zu 70 kW[8]. Die Motoren kommen ohne seltene Erden aus.[9] Neben der Möglichkeit die Antriebsbatterien konventionell über das Stromnetz aufzuladen, plant Renault den Einsatz eines sogenannten Quickdrop-Systems, bei dem innerhalb von 3 Minuten entleerte Batterien gegen volle Batterien getauscht werden können.
Für Oktober 2012 kündigt Renault einen Ausbau der Investitionen in Brasilien an. Ab 2013 soll im Werk in Curitiba die Produktion um 100.000 Einheiten jährlich auf 350.000 Kraftfahrzeuge erhöht werden. Dafür werden 200 Millionen Euro investiert.[10]
Unternehmensinformationen
Die französische Regierung hält 15 Prozent der Unternehmensanteile.[11]
Vertrieb in Deutschland
Der Vertrieb wird über die Tochtergesellschaft Renault Retail Group mit Niederlassungen in den Städten Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln und München sowie über Vertragshändler abgewickelt. 2008 ging die Retailgroup aus der REAGROUP hervor. 2004 wurde auch der Vertrieb der Marke Dacia übernommen.
Renault-Werke mit Fahrzeugtypen, Zulieferern und Produktionszahlen (2011)
|
|
Statistik
Verkaufte Autos des Renault Konzerns (inklusive aller Töchter)[14]
- 1996 1,84 Mio.
- 1997 1,90 Mio.
- 1998 2,21 Mio.
- 1999 2,37 Mio.
- 2000 2,38 Mio.
- 2001 2,41 Mio.
- 2002 2,40 Mio.
- 2003 2,39 Mio.
- 2004 2,49 Mio.
- 2005 2,53 Mio.
- 2006 2,43 Mio.
- 2007 2,48 Mio.
- 2008 2,38 Mio.
- 2009 2,31 Mio.
- 2010 2,63 Mio.
- 2011 2,72 Mio.
- 2012 2,25 Mio.
- 2013 2,63 Mio.
Alle Renault-Modelle
Vorlage:Zeitleiste Renault-Modelle
1899–1918
1919–1945
Seit 1945
| Bauzeit Produzierte Fahrzeuge |
Baureihe | Anmerkung | Bild |
|---|---|---|---|
Kleinstwagen | |||
| 1993–2007 | Twingo I | Der Name "Twingo" war aus einem Phantasiewort entstanden. Das Fahrzeug soll zwei (Twin) Fahrzeugarten (Kleinwagen und Minivan) in sich vereinen und sehr flott unterwegs sein (go). Er erhielt 1998 ein Facelift (lackierte Front- und Heckstoßstange und technische Änderungen), blieb aber ansonsten unverändert. 2003 wurde er durch erweiterte Sicherheitstechnik, verbesserte Bremsen und neuem 1,2-l-16V-Motor ein weiteres Mal aufgewertet. Außerdem neu: Die Linie Initiale mit Ledersitzen, serienmäßiger Klimaanlage und optionalem Navigationssystem. Der Twingo I war wirtschaftlich erfolgreich und als Zweitwagen beliebt. Dazu trugen das auch heute noch zeitgemäße Design, ein guter Rundumblick, das Innenraumkonzept und das gegen Aufpreis erhältliche Faltdach bei. Renault produzierte von diesem Wagen viele Sondermodelle. | 
|
| 2007–2014 | Twingo II | Der zweite Twingo besaß eine größere Ausstattungsvielfalt als sein Vorgänger. Er wurde ebenfalls nur als Dreitürer gebaut. Neu hinzu kamen die Varianten Sport und RS. Auch ein Dieselmotor befand sich nun im Angebot. Des Weiteren waren einige Sondermodelle (wie Night & Day oder Nokia) erhältlich. Anfang 2012 wurde der Twingo II überarbeitet. | 
|
| ab 2014 | Twingo III | Die dritte Ausführung des Kleinwagens wurde in Zusammenarbeit mit Smart entwickelt. Wie deren kleinstes Modell wird auch der Twingo über Heckantrieb verfügen. Zudem gibt es ihn erstmals (und ausschließlich) als Fünftürer. | 
|
Kleinwagen | |||
| 1946–1961 | Renault 4CV | Wie der VW Käfer hatte der 4CV Heckantrieb, jedoch bereits mit Wasserkühlung und vier Türen. Die Ähnlichkeit des 4CV mit dem Wolfsburger KdF-Wagen kam nicht von ungefähr, der erste Prototyp sah auch fast aus wie der Volkswagen. Bei einer Audienz bei Adolf Hitler bekam Louis Renault Pläne des Autos zu sehen. In das Reich der Legende gehört, dass Porsche persönlich an der Entwicklung des 4CV beteiligt gewesen sei. Doch Renault hat den VW nicht einfach kopiert, sondern nur das Konzept übernommen. Der 4CV wartete mit technisch verbesserten Lösungen auf, wie die Wasserkühlung, vier Türen und einem größeren Kofferraum. Sein Spitzname war Crèmeschnittchen, auf Grund der nach dem Krieg knappen Ressourcen und Rohstoffe. Anfänglich wurde der Wagen nur in Sahara-Beige lackiert, da Restbestände von Farbe aus der Armee aufgebraucht wurden. Die Franzosen nannten ihren „Volkswagen“ liebevoll „Butterklumpen“ (motte de beurre), die Saarländer machten daraus das Cremeschnittchen. Insgesamt wurden 1,1 Millionen Exemplare gebaut. | 
|
| 1961–1962 | Renault 3 | Der R3 war eine nur ein Jahr lang gebaute Einsteigsversion des R4 mit sparsamster Ausstattung und kleinerem Motor. Von ihm entstanden nur 2571 Exemplare. | 
|
| 1961–1992 | Renault 4 | Er war der erste fünftürige Kleinwagen von Renault. Der R4 hat nicht nur heute den Status eines Kultobjektes, sondern brachte schon zu seiner Markteinführung viele innovative Konzepte in den Massenmarkt. Seinen Erfolg verdankte er dem Umstand, dass er praktisch, preiswert und robust war. Den R4 schätzten nicht nur die Studenten und jungen Familien der damaligen Zeit, auch die spanische Guardia Civil und die französische Gendarmerie verwendeten den R4 bis weit in die 1990er Jahre. Auch als Kastenwagen F4, 20 cm länger als F6, als Cabrio Plein Air und mit Kunststoffaufbau Rodeo war er erhältlich. Insgesamt wurde er 8 Millionen Mal verkauft. | 
|
| 1972–1996 | Renault 5 | Diente als Ergänzung zum R4 und als modernere und billiger zu produzierende Alternative zum Renault 6. Dies lag vor allem an den niedrigen Kosten und den kompakten Abmessungen. Der Wagen hatte eine selbsttragende Karosserie ohne den Plattformrahmen des R4 und R6. Die Radaufhängungen waren denen des R4 ähnlich, aber einfacher und aus weniger Teilen aufgebaut. Erhältlich waren Motoren von 850 cm³ bis 1800 cm³, zuletzt auch mit Turboaufladung im R5 Alpine Turbo (122B; 1400 cm³). Der kleine Freund, wie durch die Werbung später genannt, wurde als Drei- und (ab 1979) als Fünftürer gebaut. Ende 1984 wurde eine komplett neue Generation eingeführt, die Form blieb jedoch dem Ursprungsmodell angeglichen. Der Motor war jetzt quer eingebaut. Während seine Produktion 1990 in Frankreich endete, wurde er in Slowenien bis 1996 weiterhin gebaut. Bis 1994 blieb der R5 in Deutschland im Angebot, zuletzt nur noch mit Dieselmotor und als Sondermodell Campus. |  
|
| 1980–1986 | Renault 5 Turbo | Der Renault 5 Turbo wurde mit einem Vierzylinder-Mittelmotor mit Abgasturbolader ausgestattet und basierte auf dem R5. Der Motor war längs vor der Hinterachse eingebaut, mit einem Hubraum von 1397 cm³ leistete dieser 160 PS. Das maximale Drehmoment von 210 Nm wurde bei 3250/min erreicht. | 
|
| 1974–1983 | Renault Siete/Renault 7 | Der Siete (ab 1979: Renault 7) war eine viertürige Stufenhecklimousine auf Basis des ersten R5, die nur in und für Spanien von FASA hergestellt wurde. | 
|
| 1990–1998 | Clio I | Der erste Clio löste Mitte 1990 den erfolgreichen R5 ab. Er durchlief zwei Überarbeitungen (1994 und 1996). Eine ab 1994 angebotene Sportversion hieß 16V Williams und war ein Sondermodell, das sich vom Rennstall der Formel 1 (Williams Renault) herleitete. | 
|
| 1998–2012 | Clio II | Zweite Generation des Clio. Auch diese durchlief zwei Überarbeitungen: 2001 erfolgte das erste Facelift, das vor allem an den dynamischer gestalteten Frontscheinwerfern, neuen Rückleuchten und einer hochwertigeren Innenausstattung erkennbar war. Mit der zweiten Modellpflege 2003 wurde das Programm um einen stärkeren Dieselmotor und den überarbeiteten Renault Clio Sport (2,0-l-16V, 179 PS) ergänzt. Ab 2005 wurde der Clio II nur noch als Sondermodell Campus angeboten, das 2009 eine weitere Überarbeitung erfuhr. Er wurde auch als Sportmodell mit V6-Mittelmotor und als Rennwagen gebaut. Im Ausland gab es zusätzlich eine Stufenheckvariante, die Thalia genannt wurde. Nach 14 Jahren wurde Ende 2012 die Produktion eingestellt. |  
|
| 2005–2013 | Clio III | Der Clio III erschien erstmals als Kombiversion (Grandtour), jedoch nicht mehr als V6. Höchste Leistungsstufe ist nun der Sport mit 201 PS. Eine Modellpflege folgte im Frühjahr 2009. | 
|
| seit 2012 | Clio IV | Die vierte Generation des Clio wurde auf dem Pariser Autosalon 2012 präsentiert und ist seit November 2012 als ausschließlich fünftürige Schräghecklimousine sowie seit März 2013 als Kombi Grandtour erhältlich. | 
|
Kompaktklasse | |||
| 1937–1955 | Juvaquatre | Auf dem Pariser Autosalon 1937 wurde der Juvaquatre erstmals vorgestellt. Der Kombi folgte kurz darauf. Dieser wurde anfangs hauptsächlich von der französischen Post genutzt. 1939 kam zur zweitürigen Version auch eine viertürige Limousine auf den Markt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Produktion allerdings erheblich reduziert. Nach der Verstaatlichung des Konzern 1949 wurde 1955 die Produktion des Juvaquatre zugunsten des Renault 4CV eingestellt. Weil der aber nicht in größeren Stückzahlen verkauft werden konnte, erhielt der Juva 1954 den vorn eingebauten Motor und das Getriebe des 4CV, nur der Heckantrieb wurde beibehalten. 1956 wurde er in Dauphinoise umbenannt, bekam das Armaturenbrett und das angepasste Interieur des 4CV, wurde wahlweise als Kombi oder als Lieferwagen angeboten und übernahm damit die Rolle eines 4CV-Kombis. Dessen Produktionsende lag dann auch nur ein Jahr vor dem des 4CV. | 
|
| 1956–1968 | Dauphine | Die Dauphine war Nachfolger des 4CV und wurde wie dieser nur als viertürige Limousine mit Heckmotor verkauft. Der Name bedeutet Thronfolgerin und zielt damit auf die Verkaufserfolge des 4CV in Europa und auch in den USA. Die Leistung lag anfangs bei 26,5 PS, bis sich der Tuner Améede Gordini, der auch ehrfurchtsvoll der Hexer genannt wurde, im Auftrag von Renault des Motors annahm. Er schuf den Renault Gordini, dessen Leistung er auf 33 bzw. 36 PS bei 850 cm³ steigern konnte. Für den Automobilsport wurde 1959 noch ein R1093 oder Rallye-Dauphine genanntes Modell entwickelt, das an verschiedenen Autorennen wie der Rallye Monte Carlo teilnahm. Die Motorleistung dieses Modells wurde sogar auf 49 PS gesteigert. | 
|
| 1962–1973 | Renault 8 | Viertürige Limousine mit längs im Heck eingebautem Vierzylinder-Reihenmotor. Den R8 gab es auch in sportlichen Ausführungen (Gordini und S). Das Modell besaß Einzelradaufhängung und Scheibenbremsen an allen vier Rädern. Im Sommer 1973 wurde der R8 ohne Nachfolger eingestellt. | 
|
| 1968–1980 | Renault 6 | Der R6 wurde als etwas größerer Nachfolger des R4 konzipiert. Er richtete sich mit seinem für die damalige Zeit modernen Design, nahe dem des Renault 16, vor allem an Studenten und junge Familien. Die Frontscheinwerfer der Urversion waren rund und besaßen einen Aluminiumrahmen mit verchromtem Kühlergrill. Im Sommer 1973 wurden quadratische Frontscheinwerfer, größere Heckleuchten, Kühlergrill ohne Chromelemente und eine veränderte Kennzeichenbeleuchtung eingeführt. | 
|
| 1976–1982 | Renault 14 | Beim Renault 14 handelte es sich um das erste Modell von Renault in der Golf-Klasse. Er folgte als Schräghecklimousine mit großer Heckklappe und einem dadurch variablen Kofferraum dem heutzutage klassentypischen Karosseriekonzept der Kompaktklasse. Anders als beim VW Golf und weiteren Konkurrenten wurde der R14 nur fünftürig angeboten. Die Motoren hatten 1,2 oder 1,4 l Hubraum. Jedoch war der Erfolg eher bescheiden. Mit weiteren Leistungs- und Ausstattungsvarianten und einem Facelift im Herbst 1979 sollten größere Kundenkreise erschließen, was jedoch nicht gelang. Ende 1982 wurde die Fertigung des R14 daher eingestellt. | 
|
| 1981–1988 | Renault 9/11 | Die Schwestermodelle R9 und R11 sind beides Fahrzeuge mit Frontantrieb und querstehendem Frontmotor. Während der im Sommer 1981 eingeführte R9 eine viertürige Stufenhecklimousine war, stellte der Mitte 1983 präsentierte R11 die drei- und fünftürige Schrägheckversion dar. Die Radaufhängungen des Fahrzeugs sorgten für ein franzosentypisch weiches Fahrgefühl, trotzdem waren die Fahrzeuge auf Grund ihres geringen Gewichtes jedoch zu ansprechenden Fahrleistungen fähig. Aufgrund der geringen Pannenanfälligkeit sowie dem günstigen Verbrauch waren R9 und R11 während ihrer Produktionszeit in ganz Westeuropa weit verbreitet. Die Motoren hatten eine Leistungsspanne von 54 (1,6-l-Diesel) bis 115 PS (1,4-l-Turbo). Es wurde auch ein Prototyp mit Vierradlenkung entwickelt, der aber nie serienreif wurde. Ein Facelift des Frontbereichs Ende 1986 (die charakteristischen Doppelscheinwerfer wurden durch einfache Rechteckleuchten ersetzt) konnte den Produktionsstopp im Herbst 1988 nicht aufhalten. |  
|
| 1988–1997 | Renault 19 | Der R19 galt bei Renault als großer Fortschritt im Bereich Qualität. Zunächst im Herbst 1988 als Schrägheck auf dem Markt gebracht, folgte im Sommer 1989 ein Stufenheck (Chamade, später Bellevue). Das Cabriolet wurde ab Mitte 1991 von Karmann in Osnabrück hergestellt. Im Juni 1992 erhielt die Baureihe ein Facelift, das einen neuen Kühlergrill sowie abgedunkelte Heckleuchten brachte. Das Kennzeichen saß hinten nun in den Stoßfängern. Von 1990 bis 1994 war der R19 das meistverkaufte Importauto in Deutschland und wurde in den Jahren 1991 und 1992 jeweils etwa 100.000-mal verkauft. Ein Wert, den bisher kein Importmodell erreichen konnte. Im Herbst 1995 wurde die Produktion der Schräg- und Stufenheckmodelle in Europa beendet, das Cabrio wurde noch bis Anfang 1997 gebaut. | 
|
| 1995–2003 | Mégane I | Die erste Generation des Renault Mégane besaß Karosserieversionen als Schräg- und Stufenheck (Classic) sowie ein Coupé (bis 1999 unter dem Namen Coach) und ein auf dem Coupé basierendes Cabriolet. Im Frühjahr 1999 erfolgte eine Überarbeitung, welches eine neu gestaltete Front, neu gestaltete Rückleuchten und eine überarbeitete Innenausstattung umfasste. Zum gleichen Zeitpunkt erschien der Kombi Grandtour. Ab Oktober 2000 kamen auch neue Ausstattungslinien hinzu, ebenso ein neuer Common-Rail-Diesel und kleinere optische Verschönerungen wie eine Chromzierleiste um den Kühlergrill oder lackierte Türgriffe (je nach Ausstattungsvariante). Motoren: 64 (1,9 D) bis 115 (1,8 16V) bzw. 147 PS (2,0 16V; Coupé und Cabrio). Im November 2002 endete die Produktion des Schrägheck und die des Coupé. Stufenheck, Kombi und Cabrio wurden erst im Sommer 2003 ersetzt. | 
|
| 2002–2009 | Mégane II | Mit der zweiten Generation Mégane II setzte Renault seine beispielgebende Entwicklung in Sachen Fahrzeugsicherheit, vor allem beim Insassenschutz, fort und erreichte auch mit diesem Modell fünf Sterne im Euro-NCAP-Crashtest. Im Gegensatz zum Vorgänger fiel das unkonventionelle Design auf, was an den schon vorher erschienenen Modellen Vel Satis und Avantime erinnerte. Die Karosserievielfalt wurde beibehalten: drei- und fünftüriges Schrägheck, Stufenheck, Kombi (Grandtour) und Coupé-Cabriolet (mit faltbarem Stahldach). Anfang 2006 erhielt die Baureihe ein Facelift. Die optischen Neuerungen beschränkten sich auf eine leicht veränderte Frontpartie und neu gestaltete Heckleuchten. Bis 2010 blieben noch das Stufenheck sowie das Coupé-Cabrio CC im Programm. Motoren: 82 (1,4-l-Otto/1,5-dCi-Diesel) bis 230 PS (RS „F1 Team“). | 
|
| seit 2008 | Mégane III | Dritte Auflage des Kompaktwagens, die seit Ende November 2008 im Handel ist. Die Ausstattung des Mégane III beinhaltet zum Beispiel die Keycard-Handsfree-Funktion, einen analogen Drehzahlmesser und einen digitalen Tachometer. Das dreitürige Coupé ist seit Januar 2009 verfügbar und besitzt (wie einst der erste Mégane Coupé/Coach) eine eigenständige Karosserie. Es ist serienmäßig mit einem sportlicheren Fahrwerk und Leichtmetallfelgen ausgestattet. Ein Cabrio und ein Stufenheck (mit dem Namen Fluence) folgten im Sommer 2010. | 
|
| seit 2009 | Fluence | Der Fluence, basierend auf dem dritten Mégane, wird seit Februar 2009 hergestellt und ist im Produktionsland Südamerika seither fester Bestandteil im Modellprogramm. In Deutschland wurde der Fluence erst auf der IAA 2009 in Frankfurt präsentiert und im Spätsommer 2010 eingeführt. | 
|
Mittelklasse | |||
| 1965–1971 | Renault 10 | Viertürige Limousine mit längs im Heck eingebautem Vierzylinder-Reihenmotor. Der R10 baute auf dem gleichen Konstruktionsprinzip wie der Mitte 1962 präsentierte R8 auf, lediglich Front und Heck wurden verlängert. Während es den R8 auch in sportlichen Ausführungen (Gordini und S) gab, war der ab Herbst 1965 angebotene R10 nur als Luxusversion R10 Major zu ordern. Das Modell besaß Einzelradaufhängung und Scheibenbremsen an allen vier Rädern. Der R10 wurde im Herbst 1971 eingestellt. | 
|
| 1969–1980 | Renault 12 | Erster Mittelklassewagen von Renault mit Frontantrieb. Mitte 1971 folgte der Kombi namens Break (in Deutschland Variable). Im Sommer 1975 erfuhr der R12 eine Überarbeitung (größere Scheinwerfer sowie größerdimensionierte Heckleuchten, ebenso geänderte Stoßfänger und Armaturenbrett). Die Motoren hatten ein Leistungsspektrum von 54 (R12 L) bis 160 PS (R12 Gordini). Der R12 war in Rumänien auch unter dem Namen Dacia 1300/1400 als Limousine und 1310/1410 als Kombi in Lizenz gefertigt worden, dessen Produktion erst 2006 endete. Der Renault 12, dessen Produktion bei Renault Anfang 1980 auslief, erreichte eine Stückzahl von 4,2 Millionen. | 
|
| 1978–1986 | Renault 18 | Nachfolger des R12. Er war wie dieser als Limousine und ab Frühjahr 1979 auch als Kombi (Break) verfügbar. Letzterer wurde von Herbst 1983 bis zum Produktionsende auch als 4x4-Version angeboten. Zwei Motoren (1,4 l / 64 PS und 1,7 l / 78 PS) waren in zwei Ausstattungsvarianten für den R18 anfangs erhältlich. Das Motorenangebot wurde noch auf bis zu 2,2 l Hubraum erweitert. Hervorzuheben sind dabei der 2,1-l-Turbodiesel sowie der 1,6-l-Turbo, die eine Leistung von etwa 110 PS (später 125 PS) erbrachten. Im Frühjahr 1986 wurde die Produktion beendet. | 
|
| 1986–1995 | Renault 21 | Mittelklassewagen und Nachfolger des R18, der im Frühjahr 1986 erschien. Seine Leistungsspanne reichte von 65 (2,1-l-Diesel) bis 175 PS (2,0-l-Turbo). Er war erstmals, neben Stufenhecklimousine und Kombi (Nevada) und nach einer Modellpflege Mitte 1989, auch als Schrägheck lieferbar. Bemerkenswert auch die Karosseriestruktur. In der Karosserie befinden sich Verstärkungen aus Leichtmetalllegierungen, der Motorblock ruht gummigelagert auf dem großen Achsträger, der als Hilfsrahmen die Crashstruktur verstärkt. Die Seitenstabilität erreichen zwei Querträger im Wagenboden. Außerdem hatte der R21 je nach Modell zwei verschiedene Vorderwagen, je nach Motorisierung hatte der R21 entweder einen längs oder einen quer eingebauten Motor. Den Nevada gab es auch in einer Sonderausführung als 7-Sitzer mit dritter Sitzbank in Fahrtrichtung. | 
|
| 1994–2001 | Laguna I | Von Beginn an gab es den Laguna als Fließhecklimousine, der Ende 1995 noch der Grandtour genannte Kombi folgte. Im Frühjahr 1998 erhielt er ein Facelift. Neben neuen Motoren (1,6-l-16V/107 PS, 1,8-l-16V/120 PS, 2,0-l-16V IDE/139 PS und 1,9-l-dTi/98 PS) beinhaltete es eine umfangreichere Serienausstattung (Klimaanlage und Seitenairbag) und kleinere Retuschen (u.a. Klarglasscheinwerfer und neue Rückleuchten) beinhaltete. Das Angebot wurde auf zwei Ausstattungsvarianten reduziert, normal und Concorde. Ab Ende 1998 gab es im Laguna auch den ersten Common-Rail-Diesel (1,9-l-dCi/107 PS) von Renault. Bis Anfang 2001 wurde der Laguna I ca. 1,5 Millionen Mal gebaut. | 
|
| 2001–2007 | Laguna II | Komplett neu entwickeltes Modell, wieder als Schrägheck und Kombi (Grandtour). Als erstes Auto erreichte der Laguna II die 5 Sterne (33 Punkte = 97 Prozent, +1 Punkt für den Gurtwarner) beim Euro NCAP im Crashtest. Des Weiteren erhielt er anstelle eines herkömmlichen Schlüssels eine Chipkarte. Außerdem wurde die Ausstattung weiter ausgebaut (Authentique, Expression, Dynamique, Privilège und Initiale). Im Frühjahr 2005 wurde der Laguna II einem Facelift unterzogen, was sowohl außen (statt Nasenpflaster nun getrennter Kühlergrill) wie auch sicherheitstechnisch auffiel. Motoren: 92 (1,9-l-dCi) bis 207 PS (3,0-l-V6) | 
|
| seit 2007 | Laguna III | Der Laguna III entstammt einer Kooperation mit der Tochtermarke Nissan. Neben dem Schrägheckmodell und dem Grandtour genannten Kombi gab es ab Herbst 2008 erstmals seit Einstellung des Fuego ein Mittelklasse-Coupé. Weiteres technisches Highlight ist die in der Ausstattungsversion GT beinhaltete Allradlenkung. Die Hinterräder lenken dabei über einen Elektromotor und einer zusätzlichen Spurstange bis zu einem Grad von 3,5 Prozent ein. Die Allradlenkung lenkt bis 60 km/h gegenläufig, darüber simultan. | 
|
Obere Mittelklasse | |||
| 1951–1960 | Frégate | Die Frégate wurde auf der Paris Autoausstellung 1950 vorgestellt, wurde aber erst im November 1951 ausgeliefert. Ab 1956 kam zum ursprünglichen 2,0 l ein neuer 2.141-cm³-Motor mit 77 PS zum Einsatz. Ebenfalls 1956 kam auch die fünftürige Kombiversion namens Domaine auf den Markt. 1960 wurde die Produktion beendet. Bis dahin wurden 163.383 Frégates in Flins gebaut. Einen direkten Nachfolger gab es nicht. | 
|
| 1965–1980 | Renault 16 | Er gilt als das erste Fahrzeug mit einer Schrägheckkarosserie in der oberen Mittelklasse und wurde ab Anfang 1965 in einem neu gebauten Werk in Sandouville bei Le Havre produziert. Der R16 gewann zudem die Wahl zum Auto des Jahres 1966. Die Bauweise von Frontmotor und Frontantrieb in Verbindung mit einem Schrägheck wurde später in der Kompaktklasse aber auch in der Mittelklasse (zum Beispiel VW Passat und Audi 100 Avant) zum Standard. Die Bauweise der Rücksitzbank ermöglichte eine große Variabilität des Kofferraumes. Sie konnte mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug komplett ausgebaut werden und vergrößerte so das Ladevolumen auf bis zu 1600 Liter Stauraum. Ab 1973 wurde der R16 in einer TX-Variante mit 93 PS angeboten, der sich äußerlich durch Doppelscheinwerfer von den übrigen Varianten unterschied. Im Spätsommer 1974 wich der Aluminiumgrill bei einer weiteren Überarbeitung einem aus Plastik. Anfang 1980 wurde er aus dem Programm genommen, denn die Nachfolger R20/R30 waren bereits seit Frühjahr 1975 im Handel. | 
|
| 1975–1984 | Renault 30 | Der R30 war Renaults erstes selbst entwickeltes Fahrzeug mit 6-Zylinder-Motoren nach dem Zweiten Weltkrieg und war baugleich mit dem ein halbes Jahr später erschienenen R20, der aber durch Vierzylinder angetrieben wurde. Der Hubraum des gemeinsam mit Peugeot und Volvo entwickelten V6-Motors PRV-Motor betrug 2.664 cm³. Anfänglich stand eine Leistung von 131 PS zur Verfügung, die ab Herbst 1978 durch den zusätzlichen Benzin-Einspritzmotor auf 143 PS angehoben wurde. Zunächst nur als TS angeboten, war er serienmäßig mit Servolenkung, elektrischen Fensterhebern vorne und elektromagnetischer Zentralverriegelung ausgestattet. Anfang 1982 folgte ein 2,1-l-Turbodiesel, allerdings mit vier Zylindern. Der TS mit Vergaser entfiel Mitte 1982 und von nun an übernahm der 143 PS starke 2,7-l-V6 als R30 TX mit Einspritzung die alleinige Rolle des großen Ottomotors. Anfang 1984 wurde die Produktion des R30 eingestellt. | 
|
| 1975–1984 | Renault 20 | Vorgestellt im Oktober 1975, wurde der Renault 20 ab Februar 1976 auch in Deutschland angeboten. Äußerlich unterschied er sich vom R30 durch eine andere Fahrzeugfront mit Breitbandscheinwerfern statt runder Doppelscheinwerfer. Ansonsten waren R20 und R30 bis auf wenige technische Kleinigkeiten wie Räder, Kotflügel, Bremsen und Kraftstoffart sowie Details im Innenraum weitgehend identisch. Um die entstandene Lücke zwischen dem R16 und dem R30 zu schließen und eine Ablösung des R16 vorzubereiten, wurde der R20 ins Programm eingeführt. Er kombinierte Karosserie und Technik des R30 TS mit dem Vierzylinder-Motor aus dem R16 TX oder dem neuen Douvrin-Motor aus Leichtmetall mit 2 Liter Hubraum. Der R16 wurde jedoch parallel noch bis Anfang 1980 weiter angeboten. Während der R30 ausschließlich mit Sechszylinder-V-Motoren (abgesehen vom Anfang 1982 vorgestellten Turbodieselmotor) ausgerüstet wurde, kamen im R20 ausschließlich Vierzylinder-Reihenmotoren zum Einsatz. Wie der R30 wurde auch der R20 Anfang 1984 aus dem Programm genommen. | 
|
| 1984–1992 | Renault 25 | Beim Renault 25 wurde das Konzept eines Vierzylinder-Volumen- und eines separaten Sechszylinder-Spitzenmodells wie beim R20 und R30 aufgegeben und beide Varianten innerhalb eines Modells angeboten. Mitte 1985 brachte man eine verlängerte Version (R25 Limousine) auf den Markt, die über 30 cm mehr Platz zwischen Vorder- und Fondsitzen verfügte. Diese war an verlängerten Fondtüren und einer breiteren B-Säule zu erkennen. Sie wurde Mitte 1988 eingestellt. Zur selben Zeit erhielt der R25 ein Facelift (abgerundete Frontpartie, neue und breitere Rückleuchten). Die Abmessungen der Karosserie blieben unverändert, der Innenraum hingegen erfuhr geringe Modifikationen. Das Armaturenbrett erhielt geänderte Lüftungsschlitze. Auch die Motoren wurden der technischen Entwicklung angepasst zum Beispiel wurden alle Benziner mit einem 3-Wege-Katalysator ausgerüstet. Das Topmodell wurde in der Baccara-Version angeboten, die unter anderem Klimaautomatik, Lederausstattung und Wurzelholzapplikationen beinhaltete. Anfang 1992 wurde die Fertigung des R25 beendet. | 
|
| 1992–2000 | Safrane | Der Safrane weist in der Grundform starke Parallelen zum Vorgänger auf und hat wie auch der R25 ein Fließheck mit großer Heckklappe. Die Motorenpalette startete bei 107 PS aus einem 2,2-Liter-4-Zylinder-Motor, der es in einer dreiventiligen Variante auf 137 PS brachte. Darüber hinaus gab es noch den bekannten V6-Motor (bekannt als Europa-V6 oder PRV-Motor) mit 167 PS, der aus einer Gemeinschaftsentwicklung von Renault, PSA und Volvo stammte. Die Dieselmotoren waren anfangs ein 2,5 Liter großer Turbodiesel und 112 PS sowie ein 2,1 Liter mit 88 PS, die aber später gestrichen bzw. ersetzt wurden. Eine geringe Anzahl des von Opel-Haustuner Irmscher überarbeiteten Safrane Biturbo gab es zeitweise beim Renault-Händler zu kaufen. Dieser durch zwei Turbolader unterstützte Sechszylinder leistete 267 PS und hatte entsprechende Fahrleistungen (250 km/h). Das Fahrzeug wurde in Kleinserie von 640 Stück bei Irmscher in Remshalden bei Stuttgart hergestellt. Im Sommer 1996 erfolgte ein Facelift, das im Wesentlichen technische Vorteile brachte wie modernere Motoren. Dazu gehörten ein 2,0-l-16V-Vierzylinder mit 136 PS, ein 2,5-l-20V-Fünfzylinder mit 165 PS, ein 2,2-l-12V-Vierzylinder-Turbodiesel mit 113 PS sowie ab 1999 als Topmotorisierung ein 3,0-l-24V-Sechszylinder mit 190 PS. Sicherheitstechnisch gab es beim Safrane von Anfang an ABS serienmäßig, ab 1994 dann auch Airbags für alle Modelle. Von Anfang an gab es Airbags nur bei den V6-Modellen RT+RXE. Im Sommer 2000 wurde auch seine Produktion eingestellt. | 
|
| 2002–2009 | Vel Satis | Der Vel Satis löste im April 2002 den Safrane ab, nachdem ein Jahr zuvor eine Studie mit ungewöhnlichem Design gezeigt wurde. Der Mut zu einem vom herkömmlichen Erscheinungsbild von Modellen der oberen Mittelklasse deutlich abweichenden Design ist allerdings bislang zumindest von deutschen Käufern nicht belohnt worden. Im April 2005 wurde der Vel Satis einem Facelift unterzogen. Äußerlich beschränken sich die Änderungen auf einen neuen Kühlergrill mit waagerechten anstatt senkrechten Lamellen; am Heck kommen andere Rückleuchten und eine veränderte Heckschürze zum Einsatz. Neben neuen Außenlackierungen und Leichtmetallrädern haben alle Faceliftmodelle verchromte Türgriffe. Im Innenraum werden neue Armaturen, Stoffe und Materialien verwendet. Weiterhin wurden die Radio- und Navigationssysteme optimiert und die Ausstattungen erweitert. Im Jahre 2003 konnte Renault in Deutschland 1570 Vel Satis absetzen, ein Jahr später waren es 699, im Jahr 2008 mittlerweile nur noch 51. Motoren: 116 (2,2-l-dCi) bis 241 PS (3,5-l-V6-24V). Ende 2009 wurde seine Produktion eingestellt. | 
|
| seit 2010 | Latitude | Der Latitude beerbt seit Ende 2010 den eher glücklosen Vel Satis. Im Gegensatz zu diesem ist er jedoch kein reiner Renault, denn er basiert auf der Plattform des koreanischen Samsung SM5 von Renault Samsung Motors und wird auch im gleichen Werk wie dieser gebaut. Der Latitude ist somit mit dem Nissan Maxima verwandt. Motoren und Antriebsstränge wurden vom Laguna übernommen. Der Vertrieb nach Deutschland wurde im Herbst 2012 aufgrund geringer Nachfrage vorzeitig beendet. | 
|
Coupé / Sportwagen | |||
| 1955–1995 | Alpine Renault | Die als „Alpine Renault“ bzw. „Renault Alpine“ bekannten Fahrzeuge wurden nicht von Renault, sondern von Alpine entwickelt und hergestellt. Sie werden offiziell in den Fahrzeugpapieren dem Sportwagenhersteller Alpine zugeordnet und nicht der Marke Renault. Daher werden die Fahrzeuge bei Alpine beschrieben. Alpine ist eine eigenständige französische Sportwagenmarke, die 1955 von Jean Rédélé gegründet wurde. Alpine wurde 1978 zum Tochterunternehmen von Renault und gehört seit Januar 2013 zu 50 % dem Sportwagenhersteller Caterham Cars und zu 50 % Renault. | 
|
| 1959–1968 | Floride/Caravelle | Die Cabrio- und Coupé-Varianten auf Basis der Dauphine. Sie wurden primär für den amerikanischen Markt ausgelegt. Außerhalb der USA waren die Fahrzeuge in den ersten vier Jahren als Floride bekannt, erhielten 1963 auch in Europa den Namen Caravelle. Als die Dauphine eingestellt wurde, folgte eine Überarbeitung und Umstellung der Motoren, die nun vom R8 stammten. | 
|
| 1971–1979 | Renault 15 | Ein Coupé auf Basis der R12 mit bis zu 90 PS (R15 TS). Der R15 TL hatte einen Vierzylinder-Reihenmotor mit 1289 cm³ Hubraum (Vmax: 150 km/h). Die Vorderräder sind einzeln an Querlenkern mit Schraubenfedern aufgehängt und mit hydraulischen Teleskopstoßdämpfern und Stabilisatoren versehen. Das gleichzeitig erschienene Modell Renault R15 TS hatte einen Motor mit 1565 cm³ Hubraum und erreichte 170 km/h. Alternativ waren ein manuelles Vierganggetriebe mit Mittelschaltung oder eine 3-stufige Automatik erhältlich. 1975 erhielten die Modelle TS und Automatic einen größeren Motor mit 1605 cm³ Hubraum. Im Frühjahr 1976 wurden Front und Heck aller Modelle überarbeitet (breitere Scheinwerfer). Der R15 GTL besaß nun eine bessere Ausstattung (zum Beispiel Einzelsitze vorne). Im Sommer 1979 wurde die Fertigung eingestellt. | 
|
| 1971–1979 | Renault 17 | Ein weiterer Coupé-Ableger des R12. Der Renault 17 TL hat einen Vierzylinder-Reihenmotor mit 1565 cm³ Hubraum (Vmax: 170 km/h). Vorne sind Scheibenbremsen eingebaut, hinten Trommelbremsen. Neben der Coupé-Version gab es einen R17 Targa, bei dem das Dachmittelteil herausgenommen werden kann. Das gleichzeitig erschienene Modell Renault 17 TS erreichte aus 108 PS 180 km/h. Alternativ waren ein manuelles Vierganggetriebe mit Mittelschaltung oder eine dreistufige Automatik erhältlich. Mitte 1974 wurde der Renault 17TS (auf Grund des Wegfalls des R12 Gordini) in Renault 17 Gordini umbenannt. Im Frühjahr 1976 erhielt der TS einen neuen Motor mit 1647 cm³ Hubraum, mit dem er 170 km/h erreichte. Zudem wurde er auch optisch überarbeitet. Die Produktion endete im Sommer 1979. | 
|
| 1979–1986 | Renault Fuego | Ein Coupé mit großer kuppelartiger Heckklappe auf Basis des R18, das zum Marktstart im Frühjahr 1980 die Modelle R15 und R17 beerbte. Sein Motoren leisteten zwischen 64 (1,4 l) und 132 PS (1,6-l-Turbo). Mitte 1984 erfolgten leichte Überarbeitungen an der Karosserie sowie im Innenraum. In Frankreich war der Fuego sogar mit einem Dieselmotor erhältlich. Anfang 1986 wurde die Produktion in Frankreich eingestellt. In Südamerika lief das Fahrzeug noch bis Ende 1992 vom Band. | 
|
| 1995–1999 | Spider | Offener Zweisitzer-Roadster. In seiner Bauzeit wurde er auch als Straßenversion mit Windabweiser oder mit einer beheizbaren Windschutzscheibe hergestellt. Das Fahrzeugkonzept des Spider basiert auf einem Aluminium-Framework. Bestehend aus einem Hauptrahmen sowie zwei Hilfsrahmen vorne und hinten. Der Motor ist als Mittelmotor im hinteren Hilfsrahmen quer eingebaut und leistet aus 2,0 Litern Hubraum 108 kW (147 PS). Das Fahrwerk besteht aus einer Einzelradaufhängung. Vorne aus doppelten Dreieckslenkern und hinten aus Dreiecksquer- und -längslenkern verstärkt durch Stabilisatoren. Vorne sind die Federbeine quer und liegend eingebaut, um die geringe Bauhöhe der Karosserie zu ermöglichen. Die Außenhaut des Spiders besteht aus GfK (glasfaserverstärktem Kunststoff) und ist mit dem Chassis verschraubt. Das Gewicht des stabilen GfK-Kleides ist für das relativ hohe Gesamtgewicht des Spider von ca. 965 kg verantwortlich. Das Gesamtpaket verhilft dem Spider aber dennoch zu respektablen Fahrleistungen. Für die entsprechende, renntaugliche Verzögerung sorgt die ursprünglich im Alpine 610 Turbo verbaute Scheibenbremsanlage. | 
|
| 2001–2003 | Avantime | Exklusives Van-Coupé auf Basis des Espace III. Der Avantime wurde bereits nach ca. 8500 Exemplaren aus dem Grund der Schließung des Fertigungsbetriebs Romorantin-Lanthenay von Matra im Frühjahr 2003 nach 15 Monaten eingestellt. | 
|
| seit 2008 | Laguna Coupé | Das Coupé auf Plattform des Laguna III ist seit November 2008 beim Händler. Die Karosserie des Coupés ist kürzer (−52 mm) und flacher (−40 mm) als bei der Laguna Limousine. Als Antrieb soll es neben einem neuentwickelten 3,0-l-V6-Diesel mit 173 kW (235 PS), die schon im Laguna II Phase 2 debütierten 2,0-l-dCi-Motoren geben. Als Ottomotoren sind der von Nissan stammende 3,5-l-V6-Motor mit 175 kW (238 PS), der u.a. auch im 350Z und gedrosselt auch im Espace sowie im Vel Satis eingebaut wird, sowie neue direkteinspritzende Zweiliter-Motoren im Einsatz. Dabei sind alle Dieselmotoren, bis auf den 1,5-l-dCi, serienmäßig mit einem Rußpartikelfilter ausgestattet. Die V6-Motoren sollen aber nur im Coupé zum Einsatz kommen. | 
|
| seit 2009 | Mégane Coupé | Seit dem 23. Januar 2009 ist die dritte Generation des Renault Mégane Coupé auf dem Markt. Es hat eine eigenständige Karosserie und ist serienmäßig mit einem sportlicheren Fahrwerk (12 mm tiefer als der Fünftürer) und Leichtmetallfelgen ausgestattet. Im November 2009 folgte die Sportversion R.S. vom Mégane Coupé mit einem 2,0-l-16V-Turbomotor (TCe), der 184 kW (250 PS) leistet. |  
|
| 2010–2013 | Wind | Im Sommer 2010 führte Renault den auf dem Twingo II basierenden Wind ein. Es handelte sich hierbei um ein Coupé-Cabrio, das über ein elektrisch versenkbares Hardtop verfügt und als reiner Zweisitzer konzipiert war. Er wurde nur mit den beiden stärksten Benzinmotoren (1,2 TCe mit 102 PS und 1,6 mit 133 PS) des Twindo angeboten. Auch eine sportliche Version namens Gordini war zeitweise erhältlich. Mitte 2013 stellte Renault die Fertigung ein. | 
|
SUV | |||
| seit 2008 | Koleos | Der Koleos ist nach dem Scénic RX4 bzw. Scénic Conquest das zweite Sport Utility Vehicle von Renault. In Europa wird er seit Sommer 2008 angeboten. Der Koleos wurde von der Renault-Designabteilung in Zusammenarbeit mit dem Designzentrum von Renault Samsung Motors in Korea entwickelt. In Ostasien wird das Fahrzeug als Samsung QM5 vertrieben. Er teilt sich die Plattform mit dem Nissan X-Trail. Gebaut wird der Koleos im Samsung Hauptwerk (Busan, Südkorea). Für den Koleos gibt es zwei 2-Liter-Turbodieselmotoren mit Common-Rail-Einspritzung und 110 bzw. 127 kW (150 bzw. 173 PS) sowie einen 2,5-Liter-Ottomotor mit 126 kW (172 PS).
Im Spätsommer 2011 wurde der Koleos überarbeitet. |

|
| seit 2013 | Captur | Der Renault Captur wurde Mitte 2013 als Nachfolger des Modus eingeführt. Technisch basiert er auf der vierten Generation des Renault Clio. Es werden vorerst drei Motoren angeboten, davon zwei Turbobenziner mit 66 kW (90 PS) bzw. 88 kW (120 PS) und ein Turbodiesel mit 66 kW (90 PS). | 
|
Vans | |||
| 1950–1957 | Colorale | Der Colorale war die erste Nachkriegsentwicklung von Renault, die in Serie ging (4CV und Juvaquatre waren Kriegs- bzw. Vorkriegsentwicklungen) und der eine ganz bestimmte Klientel ansprach: Die Baubranche, Kommunen und Land- und Forstwirte. Der 4CV war das Fahrzeug, das die Franzosen wieder mobil machte, der Juvaquatre, besonders als Kombi 300 kg, war das Auto für Handwerk und Handel. Der Colorale sollte für den harten Alltagseinsatz herhalten. Der Name, ein Kunstwort aus Coloniale und Nurale zusammengesetzt, sollte das dem Käufer suggerieren. Es wurde in vielen Varianten hergestellt. Als Kombi (z. B. für den Einsatz im Taxibetrieb), als Abschleppwagen, als Transporter, sogar als Modell Savanne wurde er angeboten, ohne Seitenscheiben, dafür mit Lederrollos. | 
|
| 1984–1990 | Espace I | Der Espace I (interne Bezeichnung: J11) kam im Frühjahr 1984 als erste Großraumlimousine europäischer Herkunft auf den Markt - ein Alleinstellungsmerkmal, das für volle zehn Jahre Bestand hatte. Bemerkenswert ferner: die Vorgeschichte des Modelles (entwickelt und produziert durch Matra, ursprünglich vorgesehen zum Verkauf als Talbot). Allerdings stand Matra, nachdem der Espace entwickelt war, in Sochaux vor verschlossenen Türen, der PSA-Konzern war von dem Konzept nicht mehr überzeugt. Renault erkannte das Potential, stattete die ersten Prototypen mit der Technik des R18 aus. Dann seine Konstruktion (Stahlchassis mit GfK-Karosserie) sowie sein Rostschutz (per Tauchverfahren im Zinkbad) und seine Innenraumgestaltung (erster Van weltweit mit herausnehmbaren Einzelsitzen hinten und drehbaren Vordersitzen). Antriebstechnisch war der Espace an der Grenze zwischen Mittelklasse und gehobener Mittelklasse positioniert. Die verwendeten Motoren stammten aus dem R18 bzw. R20/R30: Anfangs ein 2,0-l-Vergasermotor mit 81 kW (110 PS) sowie ein 2,1-l-Turbodiesel mit 65 kW (88 PS), später ein 2,2-l-Einspritzer mit 79 kW (107 PS). Der Vergaser wurde ab Anfang 1988 Mit dem zeitgleich erfolgten Facelift in Deutschland nicht mehr angeboten, aber nun waren erstmals Allradantrieb und Klimaanlage lieferbar. | 
|
| 1991–1996 | Espace II | Der Espace II (interne Bezeichnung: J63) war eine Weiterentwicklung auf Basis des Espace I mit einer völlig neu gestalteten, jetzt stark abgerundeten Kunststoffkarosserie. Durch die Abrundung der Front passte jetzt der V6-Motor aus dem R25 (2,9 l; 110 kW / 150 PS) unter die weiterhin kurze Haube. Auch war jetzt in Verbindung mit beiden Ottomotoren eine Vierstufenautomatik lieferbar. Ansonsten unterschied sich der Espace II nur optisch vom Espace I. Das änderte sich 1994, als nach einem katastrophalen Crashtest ein Fahrerairbag und Gurtstraffer eingeführt und die Karosserie verstärkt wurde. | 
|
| 1996–2003 | Scénic I | Kompaktvan auf Basis des Mégane I. Er wurde anfangs sogar als Mégane Scénic, nach dem Facelift im Sommer 1999 als Scénic verkauft und wurde damit als eigenständiges Modell in der Historie weitergeführt. Ab Herbst 2000 gab es ihn noch zusätzlich mit Allradantrieb und SUV-Optik als Scénic RX4. | 
|
| 1996–2002 | Espace III | Auch der Espace III (interne Bezeichnung: JE) wurde von Matra entwickelt und produziert. Erstmals war der Motor (analog zum Safrane) quer eingebaut, weshalb ein Allradantrieb aufwendiger zu realisieren gewesen wäre als beim Vorgänger. Dieser war nun nicht mehr lieferbar. Das vollverzinkte Stahlchassis mit der GFK-Karosserie blieb aber erhalten. Die Produktion startete im Oktober 1996 (in Deutschland verfügbar ab Anfang 1997). Auf der IAA 1997 wurde Anfang 1998 eine um 30 cm verlängerte Version als Grand Espace präsentiert. Die Leistungsspanne der Antriebe reichte von 72 kW (98 PS) beim 1,9-l-dTi bis zu 140 kW (190 PS) beim 3,0-l-24V. Die V6-Modelle waren (im Gegensatz zum Vorgänger) ausschließlich mit Automatik verfügbar. Einen großen Sprung gegenüber dem Vorgänger gab es in der Innenraumgestaltung, denn erstmals kamen im Espace digitale Armaturen zum Einsatz. | 
|
| seit 2002 | Espace IV | Mit dem Espace IV (interne Bezeichnung: JK; von Anfang an auch als Grand Espace erhältlich) änderte sich praktisch alles: Dieses Modell wird nicht mehr bei Matra, sondern bei Renault produziert. Es besitzt nicht mehr die Verbundbauweise der Vorgängermodelle, sondern eine klassische Stahlblechkarosse, die mit Anbauteilen aus unterschiedlichen Materialien (Kunststoffe, Leichtmetalle) ergänzt ist. Aufgrund der nun in den Rücksitzen integrierten Gurten sind diese wesentlich schwerer als bei den früheren Modellen. Drehsitze vorn sind seit 2006 nicht mehr lieferbar. Dafür gilt der Espace auch nach sieben Jahren Produktionszeit (Stand 10/2009) als absolut zeitgemäßer Van, in Sachen Fahrkomfort und Geräuschentwicklung sogar als Referenz. Die Motorisierung begann mit dem 1,9-l-dCi für 89 kW (120 PS, seit 2006 nicht mehr lieferbar) und endet mit dem 3,5-l-24V für 177 kW (241 PS). Die Zukunft des Espace gilt derzeit jedoch als unklar. Eine Neuentwicklung (geplante Markteinführung 2009/2010) wurde bereits 2008 gestoppt. | 
|
| 2003–2009 | Scénic II | Kompaktvan auf Basis des Mégane II. Diesmal gab es erstmals auch eine Langversion, die seitdem auf den Namen Grand Scénic hört. 2006 folgte eine Modellpflege, die dem Mégane entsprach und nun die aktuelle Designlinie präsentierte. Auch hier gab es ein Modell in SUV-Optik, Scénic Conquest genannt. | 
|
| 2004–2012 | Modus | Ein Minivan, der vom Twingo I und Clio II abgeleitet ist. Im Frühjahr 2008 erhielt er ein Facelift, das sowohl optische (andere Scheinwerfer und Heckleuchten) als auch technische Neuerungen (neue Motoren) brachte. | 
|
| seit 2009 | Scénic III | Kompaktvan auf Plattform des Mégane III. Auch ihn gibt es wieder als Standard- und Langversion, jedoch besitzen sie erstmals unterschiedliche Heckpartien. Ein erstes Facelift erfolgte Anfang 2012, bei dem LED-Lichter und weitere Assistens-Systeme ins Programm aufgenommen wurden. Im Frühjahr 2013 wurden die Scénic-Modelle ein weiteres Mal modifiziert. Seitdem gibt es auch wieder eine höhergelegene Variante, die nun X-MOD genannt wird. | 
|
Kastenwagen | |||
| 1965–1992 | Renault 4 F4 / F6 | Der Plattformrahmen des R4 ermöglichte es, darauf auch andere Karosserievarianten zu montieren. So gab es ihn zwischen Mitte 1965 und Ende 1992 als Kastenwagen Renault 4 F4 und zwischen Anfang 1975 und Ende 1990 als Renault 4 F6 mit 20 cm längerem Radstand und Aufbau. | 
|
| 1985–1998 | Rapid | Der Rapid war ein beliebter Kastenwagen, der auf der zweiten Generation des Renault 5 basierte und Mitte 1985 eingeführt wurde. Zwei Überarbeitungen erfolgten Mitte 1991 und Anfang 1994. | 
|
| 1998–2007 | Kangoo I | Der Kangoo war nach dem im Herbst 1996 erschienenen Citroën Berlingo der zweite Hochdachkombi und der erste mit einer, später sogar mit zwei seitlichen Schiebetüren. Da diese maßgebend zur Etablierung dieser Klasse beitrugen, sehen ihn viele als deren Begründer. Der Kangoo hat hinten eine Drehstabfederung, wie sie heute nur noch selten Anwendung findet. Als Basis diente der Clio II. Im Frühjahr 2003 kam ein überarbeitetes Modell auf den Markt, dessen Frontpartie optisch an die anderen Renault-Modelle angeglichen wurde. Im Oktober 2005 wurde nochmals ein leichtes Facelift durchgeführt. Sein baugleicher Bruder kam als Nissan Kubistar auf den Markt. | 
|
| seit 2008 | Kangoo II | Nachdem der erste Kangoo mehr als 2,2 Millionen Mal verkauft wurde, stellte Renault auf der IAA 2007 die Neuauflage des Kangoo vor. Dieser ist seit Anfang 2008 im Handel. Die Plattform X61 basiert nicht mehr auf dem Clio, sondern auf Mégane und Scénic. Der Kangoo wurde um 178 mm länger und misst nun 4.214 mm, was vor allem dem Innenraum zugutekommt. Neu sind unter anderem ein höhenverstellbarer Sitz sowie ein höhenverstellbares Lenkrad sowie elektrisch versenkbare Seitenscheiben in den Schiebetüren. Erstmals ist der Kangoo auch mit FAP (Rußpartikelfilter) und sechs Gängen erhältlich. Seit Anfang 2009 gibt es auch eine Lifestyle-Variante mit drei Türen, die Kangoo be bop heißt. 2012 erhielt der Kangoo Z.E. die Auszeichnung Van of the Year.[15] Mitte 2013 erhielt er ein Facelift. | 
|
Kleintransporter | |||
| 1945–1965 | Voltigeur/Goélette | 
| |
| 1959–1980 | Estafette | Der Estafette war ein damals in Frankreich sehr verbreiteter Kleintransporter von Renault. Bei der französischen Polizei fand er als Mannschaftswagen große Verbreitung. Er wurde 21 Jahre lang in drei Generationen mit insgesamt 530.000 Exemplaren gebaut. | 
|
| 1980–1997 | Master I | 
| |
| 1980–2001 | Trafic I | 
| |
| 1997–2010 | Master II | Baugleich mit Nissan Interstar und Opel Movano. 2003 folgte eine umfassende Modellpflege. | 
|
| seit 2001 | Trafic II | Auch als Evado (Familienkleinbus); baugleich mit Nissan Primastar und Opel Vivaro | 
|
| seit 2010 | Master III | 
| |
| ab 2014 | Trafic III | weiterhin baugleich mit Nissan Primastar und Opel Vivaro | |
Modelle außerhalb Europas
Für Märkte außerhalb Westeuropas wurden neben Renault-Modellen auch Modelle von Kooperationspartnern als Renault vermarktet. Vorlage:Zeitleiste Renault-Modelle außerhalb Westeuropas
Übersicht der Logos von Renault
Das Renault-Medaillon mit den Initialen der Brüder Louis, Ferdinand und Marcel Renault.
1900 bis 1906Das Panzer-Logo wurde eingeführt, da Renault nach dem Ersten Weltkrieg vorwiegend Panzer für das französische Militär herstellte.
1919 bis 1923Der Renault-Diamant nach der Verstaatlichung Renaults.
1946 bis 1959Der modernisierte Renault-Diamant mit 3D-Effekt von Victor Vasarely.
1972 bis 1992
Unternehmenschefs von Renault
|
Literatur
- Jacques Frémontier: La Forteresse ouvrière : Renault, Paris 1971
- Ulrich Knaack: Renault Personenwagen seit 1945, 1. Auflage, Motorbuch Verlag, Stuttgart 2003, ISBN 3-613-02339-3 (Typenkompass)
- Renault: ein Jahrhundert Tradition in der Spitzenklasse; [Hommage an Safrane], Régie Nationale des Usines Renault <Boulogne-Billancourt>, Paris : Ed. Mango, 1992
- Jean-Louis Loubet: Renault : histoire d'une entreprise, Boulogne Billancourt : E.T.A.I., 2000
Weblinks
- Offizielle Website (Deutschland)
- Offizielle Website (Österreich)
- Offizielle Website (Schweiz)
- Offizielle Website Renault Trucks (Deutschland)
- Offizielle Website Renault Trucks (Schweiz)
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Renault Group: 2011 Annual Report. (PDF; 19,4 MB) Abgerufen am 24. August 2012 (english).
- ↑ vgl. Renault: ein Jahrhundert Tradition in der Spitzenklasse
- ↑ Das neue Stammwerk auf Séguin, Geschichts-Darstellung auf Renault.de; abgerufen am 27. Januar 2011
- ↑ Suizid-Serie bei Renault, télépolis, 2007
- ↑ Renault trägt Mitschuld in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 18. Dezember 2009
- ↑ Kooperation Renault-Daimler auf Renault.de (abgerufen am 17. Juli 2010)
- ↑ Z.E. Modelle von Renault auf Renault-ze.com, abgerufen am 10. Februar 2011
- ↑ http://www.waz-online.de/Gifhorn/Gifhorn/Uebersicht/Conti-Teves-E-Motoren-fuer-Renault
- ↑ Stephan Janouch Elektronik automotive Sep. 2012, S. 21.
- ↑ Renault erhöht Produktionskapazitäten in Brasilien, www.brasilnews.de, abgerufen am 9. Oktober 2011
- ↑ BBC: Renault announces 6,000 job cuts (9. September 2008) (englisch)
- ↑ 12,0 12,1 12,2 12,3 Der Spiegel 33/2012 Dietmar Hawranek, Isabell Hülsen: Fluch der Herdprämie. DER SPIEGEL vom 13. August 2012, S. 56f.
- ↑ Michael Kläsgen: Renault setzt auf superbillig. sueddeutsche.de vom 10. Februar 2012, abgerufen am 11. Februar 2012
- ↑ Renault group key figures auf Renault.com (abgerufen am 5. Mai 2014) (englisch)
- ↑ Kangoo Elektro ist Van of the Year 2012, Verkehrsrundschau, 25. November 2011, abgerufen am 5. Dezember 2013
Accor | Air Liquide | Airbus Group | ArcelorMittal | Atos | Axa | BNP Paribas | Bouygues | Capgemini | Carrefour | Crédit Agricole | Danone | Dassault Systèmes | Engie | Essilor | Hermès | Kering | L’Oréal | Legrand | LVMH | Michelin | Orange | Pernod Ricard | PSA | Publicis Groupe | Renault | Safran | Saint-Gobain | Sanofi | Schneider Electric | Société Générale | Sodexo | STMicroelectronics | Thales | Total | Unibail-Rodamco-Westfield | Veolia Environnement | Vinci | Vivendi | Worldline
| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Renault aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |